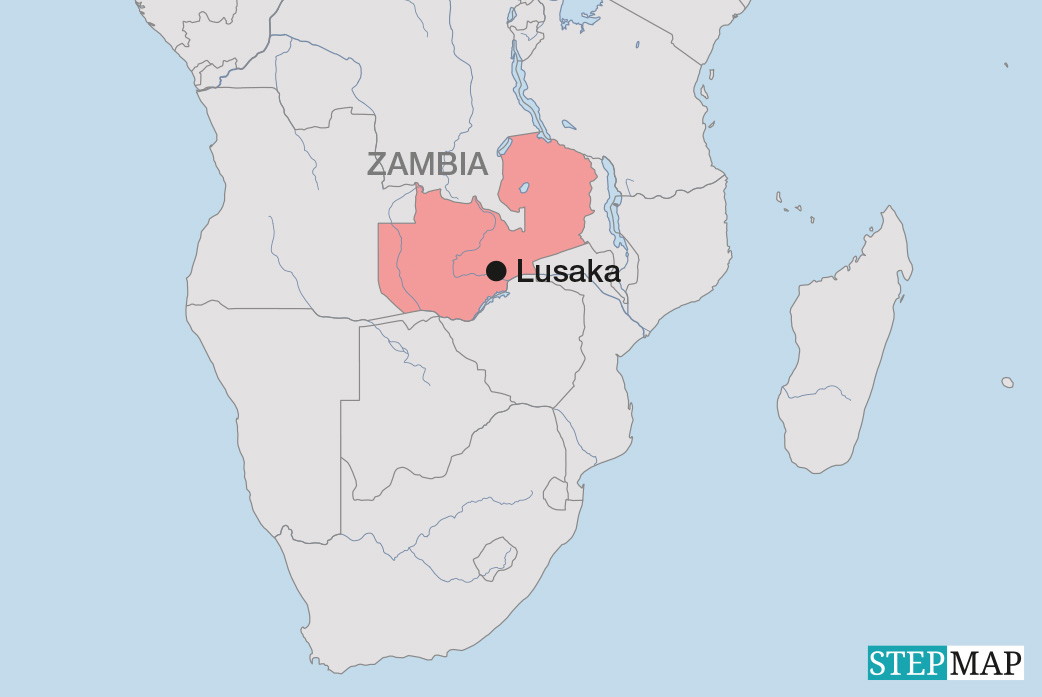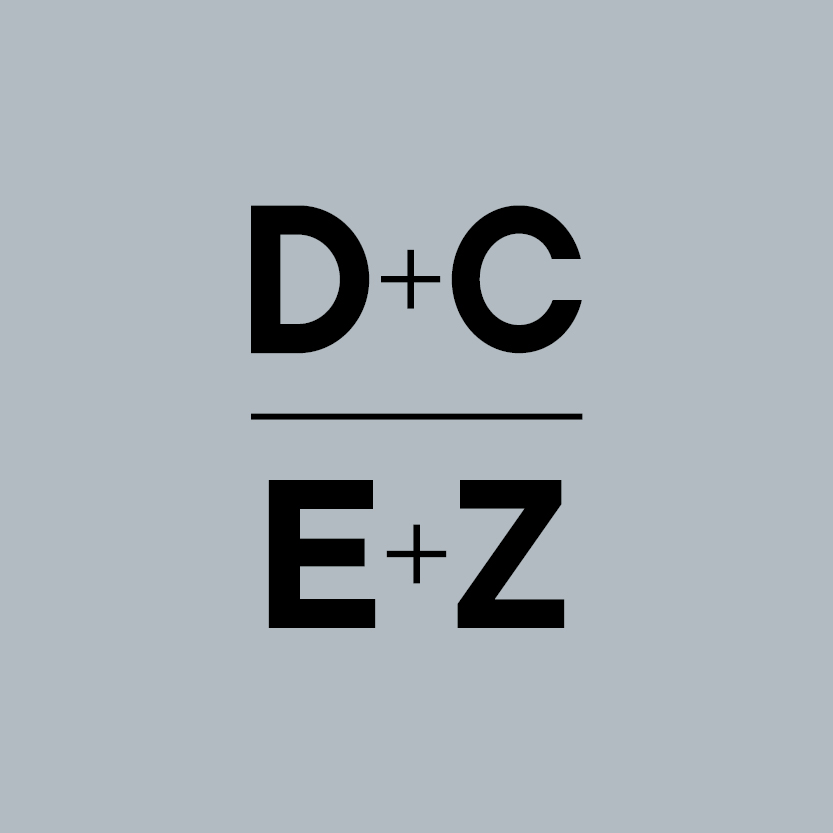Weltbank
„Wir werden immer Kritik ausgesetzt sein“

Axel van Trotsenburg im Interview mit Eva-Maria Verfürth
Herr van Trotsenburg, viele Geberländer kürzen aktuell EZ-Mittel und hinterfragen den Nutzen internationaler Zusammenarbeit. US-Präsident Donald Trump ließ überprüfen, ob die Mitgliedschaft in der Weltbank noch im eigenen Interesse ist. Wie gehen Sie mit dieser Situation um?
Nicht nur in den USA gibt es zurzeit Stimmen, die dem Multilateralismus kritisch gegenüberstehen. Das ist auch nicht neu – dieses Thema hat die Weltbank seit ihrer Gründung 1945 immer begleitet. In den ersten Jahren waren viele Investoren an der Wall Street skeptisch, ob man Anleihen von der Weltbank kaufen sollte. Ende der neunziger Jahre stellte die sogenannte Meltzer-Kommission (International Financial Institution Advisory Commission) in den USA die Arbeit der Weltbank infrage, nun das von der Heritage Foundation publizierte „Project 2025“. Als globale Organisation, die Menschen in 189 Ländern vertritt, stehen wir in der öffentlichen Debatte und werden immer Kritik ausgesetzt sein. Dem müssen wir uns stellen. Wir müssen daher immer wieder darlegen, welchen Mehrwert die Weltbank für die internationale Gemeinschaft bringt. Wir sind überzeugt, dass man durch multilaterale Zusammenarbeit viel Gutes erreichen kann.
Welche Beispiele aus den vergangenen 80 Jahren kommen Ihnen in den Sinn?
Man vergisst leicht, wie sehr sich manche Dinge verändert haben. Anfang der 1960er-Jahre haben weltweit schätzungsweise 60 % der Menschen in extremer Armut gelebt, heute sind es um die acht Prozent. Auch wenn extreme Armut also noch nicht überwunden ist, ist doch sehr viel geschehen. Einige Länder in Asien, in die erhebliche Ressourcen der Weltbank geflossen sind, haben sich beeindruckend entwickelt. Die Stärke der Weltbank ist, dass wir direkt in den Ländern vertreten sind. Rund zwei Drittel der Mitarbeiter*innen arbeiten in den über 140 Landesbüros.
Es wirkt nicht so, als würde das in der Weltpolitik aktuell besonders verfangen. Haben Sie noch genug Unterstützung für Ihre Arbeit?
Davon sind wir überzeugt. Die zur Weltbankgruppe gehörende Internationale Entwicklungsorganisation (International Development Association – IDA), die für die ärmsten Länder der Welt zuständig ist, hat Ende 2024 ihre jüngste Wiederauffüllungsrunde abgeschlossen. Trotz der schwierigen weltpolitischen Lage war es die höchste IDA-Wiederauffüllung in der Geschichte mit der höchsten Zahl an Geberländern, die sich eingebracht haben – 60 an der Zahl. Das ist überwältigend positiv. Die USA haben in ihrem aktuellen Budgetvorschlag 3,2 Milliarden Dollar für die IDA veranschlagt.
Das ist tatsächlich nur etwas weniger, als von der Biden-Regierung im Dezember zugesagt. Es war aber lange nicht sicher, wie viel es werden würde. Wie gravierend wäre es für die Weltbank, wenn der größte Geldgeber wegbricht?
Jedes Land hat seine Regierung und jede Regierung ihre Schwerpunkte – und auch der größte Geldgeber kann entscheiden, sich wieder mehr auf Inlandspolitik zu konzentrieren. Über 85 % der IDA-Gelder stammen aber gar nicht aus den USA, auch wenn sie der größte Einzelgeber sind, sondern aus anderen Ländern, wobei europäische Länder etwa die Hälfte der IDA21-Gelder beitragen.
Gerade Länder des Globalen Südens fordern mehr Mitsprache in der internationalen Finanzarchitektur. Sehen Sie die Weltbank hier in der Pflicht?
Bei der Weltbank und bei der IDA haben die großen Geldgeber bereits sehr viele Stimmanteile abgegeben. In der Anfangszeit der Weltbank hielten die beiden größten Anteilseigner der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD), die USA und UK, zusammen mehr als die Hälfte der Stimmen. Seitdem haben sie rund 60 % ihrer Stimmanteile abgetreten – ich wüsste nicht, wo es so etwas sonst je gegeben hat. Im IDA-Board halten die USA nun rund zehn Prozent der Stimmanteile. Bei den IDA-Verhandlungen hat zudem jedes Land seine Stimme, was ziemlich demokratisch ist. Im Board gibt es zwar einige Exekutivdirektoren, die nur ein Land vertreten, wie zum Beispiel die USA oder Deutschland. Die meisten vertreten aber eine Gruppe von Ländern, sodass alle repräsentiert sind.
Bei der Debatte geht es im Grunde aber noch um etwas anderes – und zwar darum, wer gehört wird. Meine Erfahrung mit der Weltbank ist, dass derjenige gehört wird, der die besten Ideen hat. Die mittelgroßen europäischen Länder etwa haben über die Jahre viele Themen eingebracht. Während der Strukturanpassungen in den 1980er-Jahren haben sie auf soziale Begleitmaßnahmen gedrängt, sie haben die Entschuldungsinitiative angestoßen und die Umwelt-, Gender- und Klimathematik eingebracht. Diese Themen wurden dann von den G7-Ländern aufgegriffen und in der Weltbank fortgeführt. Für die Weltbank sind solche Entwicklungsideen wichtig, und das macht die Organisation stärker.
Nun haben europäische Länder aber auch gute Möglichkeiten, ihren Ideen Gehör zu verschaffen. Wie steht es da mit Ländern aus dem Globalen Süden?
Wir arbeiten seit über 25 Jahren intensiv an mehr Dezentralisierung. Für unser Kreditprogramm ist es nicht nur wichtig, dass wir mit den Regierungen vor Ort zusammenarbeiten und im Blick behalten, wie die Projekte umgesetzt werden. Unsere Kolleg*innen können vor Ort auch besser neue Ideen aufgreifen. Die Idee für unsere Bargeldtransferprogramme beispielsweise kam ursprünglich aus Lateinamerika. Das mexikanische Programm „Oportunidades“ hat um die Jahrtausendwende sehr viele arme Menschen erreicht. Das Modell wurde dann erst auf Lateinamerika ausgeweitet und mittlerweile gibt es ähnliche Programme auf der ganzen Welt.
2022 hat die Weltbank ihre Vision einer „Welt ohne Armut“ erweitert zu einer „Welt ohne Armut auf einem lebenswerten Planeten“. Was verstehen Sie darunter?
Armutsbekämpfung möchten wir auf einem Planeten erreichen, auf dem das auch nachhaltig möglich ist. Das bezieht sich nicht nur auf Klima und Umwelt, sondern zum Beispiel auch auf Konflikte, durch die Regionen nicht mehr lebenswert sind.
Ein Jahr später hat sich die Weltbank dazu verpflichtet, bis 2025 nahezu die Hälfte ihrer jährlichen Finanzierungen für klimabezogene Projekte bereitzustellen. So gibt es etwa Pläne für ein großes Energieprojekt in Afrika. Worum geht es dabei?
Energieversorgung ist ein ganz zentrales Thema, vor allem für die ärmsten Länder, die wir über die IDA unterstützen. 600 Millionen Menschen in Afrika haben keinen Zugang zu Elektrizität. Mit dem Projekt „Mission 300“ möchten wir 300 Millionen von ihnen bis 2030 Zugang zu Strom verschaffen. Wir arbeiten dafür mit afrikanischen Regierungen zusammen, dem Privatsektor und bilateralen Geldgebern. Wir fördern auch die Zusammenarbeit zwischen afrikanischen Ländern, damit sie den Netzausbau vorantreiben. Das ist ambitioniert, aber wir finden, dass man sich solchen Herausforderungen stellen sollte, wenn man schnellere Fortschritte möchte.
„Mission 300“ wird von NGOs dafür kritisiert, dass fossile Energiequellen nicht ausgenommen sind, insbesondere Gas. Im Juni machte zudem die Nachricht die Runde, dass Weltbankpräsident Ajay Banga auch die Finanzierung von Atomstrom nicht mehr ausschließt. Eine Entscheidung, die unter anderem im Einklang mit Forderungen der USA steht. Was halten Sie von der Kritik, und wie kommt es zum Kurswechsel beim Thema Atomenergie?
Gas wird weltweit von vielen Expert*innen als wichtiger Übergangsbrennstoff angesehen, unter anderem in der EU. Genauso halten wir es auch: Gas darf im Energiemix vorkommen, aber eben nur als Zwischenlösung. Wir gehen davon aus, dass wir auch Wasserkraft und Thermalenergie fördern werden. Das Thema Atomkraft wurde von mehreren Exekutivdirektor*innen bei der Weltbank eingebracht, da es in vielen Ländern diskutiert wird – nicht nur in einigen OECD-Ländern, sondern auch in Entwicklungsländern. Man muss wissen, dass die Weltbank aber noch nie den Bau von Kernkraftanlagen selbst finanziert hat – abgesehen von einer Förderung im Jahr 1959 für Italien. Wir werden jetzt mit der Internationalen Atomenergie-Organisation (International Atomic Energy Agency, IAEA) zusammenarbeiten und Länder zunächst beraten, was ihre Optionen in diesem Bereich sind.
Die hohe IDA-Wiederauffüllung war ein positives Signal, dennoch werden anderswo EZ-Mittel gekürzt, und es fehlen weltweit jährlich Billionen Dollar an Finanzierung, um die SDGs zu erreichen. Auf der Hamburg Sustainability Conference im Juni haben Sie daher dafür plädiert, den Privatsektor stärker einzubeziehen. Worauf zielen Sie damit ab?
In erster Linie geht es uns darum, öffentliche Gelder zu steigern oder sie bestmöglich zu verwenden. Die Hebelwirkung, die wir über die Weltbank am Kapitalmarkt erreichen, kann hier eine wichtige Rolle spielen: Für jeden Dollar, der in die IBRD einbezahlt wird, können wir Finanzierungszusagen von bis zu zehn Dollar in zehn Jahren machen. Selbst bei der IDA gibt es eine Hebelwirkung von eins zu vier. Hier wird aus dem Geld der Steuerzahler*innen mehr herausgeholt – und gerade, wenn es Kürzungen in öffentlichen Budgets gibt, sollte man das nutzen. Darüber hinaus stellt sich aber natürlich auch die Frage, wie man Privatfinanzierungen steigern kann.
Der Einfluss internationaler Privatinvestitionen ist bisher hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Insbesondere nach Subsahara-Afrika fließt nur wenig Kapital. Ist es realistisch, auf Privatkapital zu setzen, wenn man die ärmsten Länder erreichen will?
Aus dem internationalen Privatsektor fließt ja durchaus viel Geld, aber vor allem in Länder, die das erfolgreich anziehen, wie in Ostasien. Diese Voraussetzungen möchten wir auch in anderen, insbesondere den ärmsten, Ländern schaffen, etwa über Risikoabsicherungen oder Bürgschaften. Das IDA-Programm „Private Sector Window“ fördert über Risikoabsicherung private Investitionen in den ärmsten und fragilsten Ländern, was ich persönlich für sehr wichtig halte. Wir sollten diese Derisking-Instrumente nicht nur in der Weltbankgruppe, sondern auch in multilateralen und bilateralen Entwicklungsbanken weiterentwickeln. Ansonsten wird der Privatsektor sich zurückhalten. Darüber hinaus sind wir aber auch überzeugt, dass im Inland viel passieren muss, etwa durch bessere Steuersysteme. Die Erfolgsgeschichten in Asien basieren zum großen Teil auf erfolgreicher einheimischer Ressourcenmobilisierung. Weder die ODA-Mittel noch die ausländischen Privatsektorinvestitionen allein werden je ausreichen – die Länder müssen auch ihre eigenen Einnahmen maximieren.
Axel van Trotsenburg ist Senior Managing Director der Weltbank.
press@worldbank.org