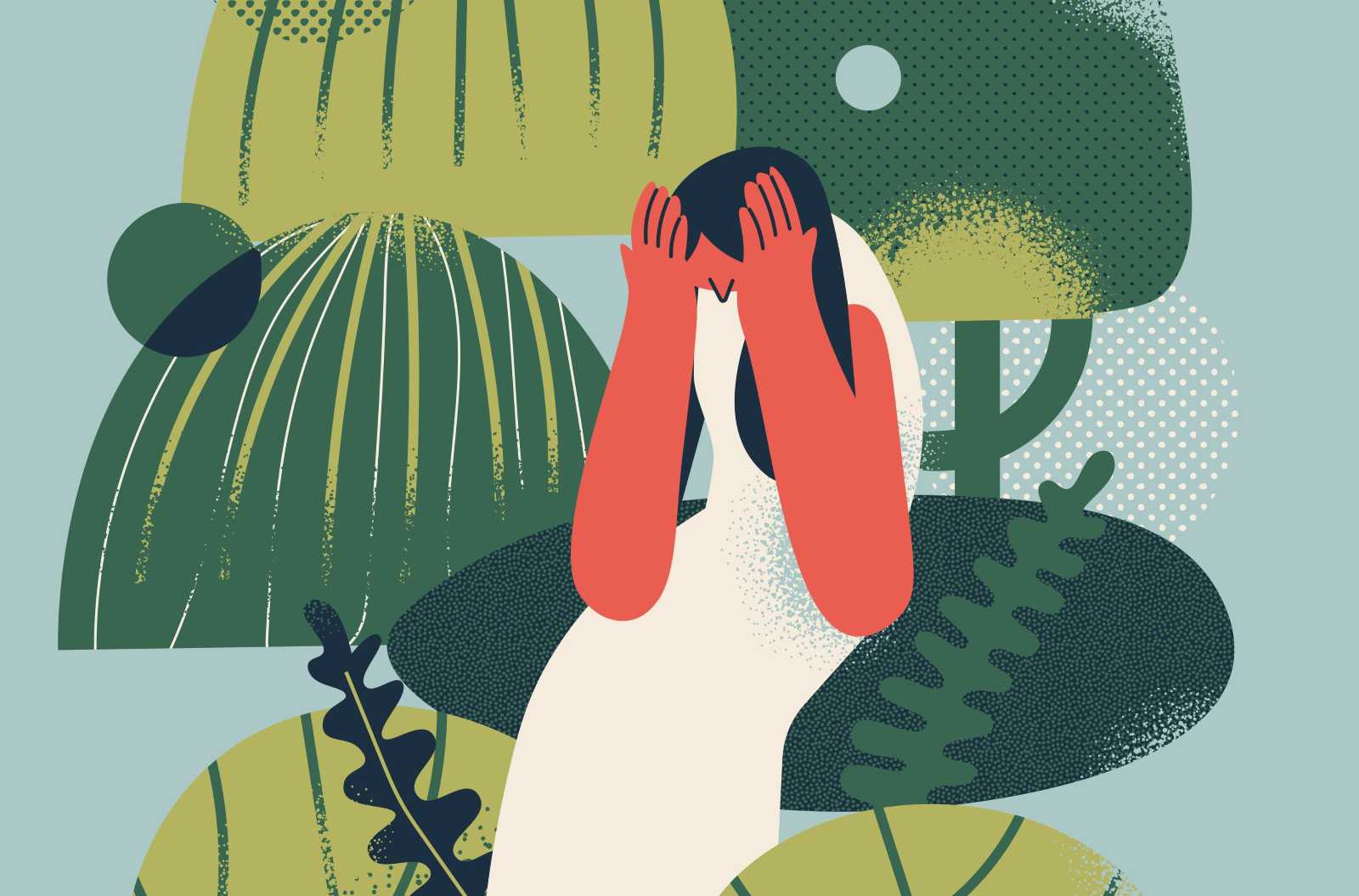Internationale Zusammenarbeit
„Wir leben nicht im Zeitalter der Perspektivlosigkeit“

Achim Steiner im Gespräch mit Eva-Maria Verfürth
Herr Steiner, die Entwicklungspolitik ist im Umbruch: Schon in den letzten Jahren haben viele OECD-Länder ihre Gelder umgewidmet und mehr für die Ukraine oder Flüchtlingsarbeit im eigenen Land ausgegeben. In Deutschland wird der Sinn von Entwicklungszusammenarbeit (EZ) zunehmend in Frage gestellt. Wie erleben Sie diese Zeit?
Wir erleben einen Moment großer Unsicherheit. Niemand kann genau vorhersagen, was die kommenden Monate oder Jahre bringen werden. Zugleich wachsen die geopolitischen Spannungen, es gibt mehr Konflikte und Instabilität. Da fragt man sich schon: Wird es uns gelingen, diesen Krisen gemeinsam zu begegnen?
Die Frage stellen sich sicher viele im Augenblick. Was muss geschehen, damit das gelingen kann?
Wir müssen zusammenarbeiten. Multilateralismus ist kein bloßes Credo – es ist die Plattform, die uns ermöglicht, trotz aller Unterschiede gemeinsam in die Zukunft zu investieren. Globale Herausforderungen wie Pandemien, Cybercrime oder Klimawandel lassen sich nur gemeinsam bewältigen. Dass internationale Kooperation abgewertet und zum Spielball nationaler Debatten wird, macht mir große Sorgen. In dieser Größenordnung haben wir das lange nicht mehr erlebt. Hinzu kommt, dass wir unsere internationalen Institutionen seit Jahren vernachlässigt haben. In den 1990er- und 2000er-Jahren schien die Welt so stabil, dass multilaterale Strukturen weniger notwendig schienen. Jetzt werden wir erkennen, wie unverzichtbar sie sind, und wie zentral die Rolle der Entwicklungszusammenarbeit ist.
Schon bevor die USA auf Konfrontationskurs mit dem Multilateralismus gegangen sind, war diese Zusammenarbeit nicht immer einfach. Auf der COP29 forderten die EU und die USA China auf, sich stärker an der Klimafinanzierung zu beteiligen. Zu Recht?
Grundsätzlich ja – doch viele unterschätzen, dass China bereits ein Schlüsselakteur bei der globalen Energiewende ist und für viele Entwicklungsländer den Umstieg auf Solar- und Windkraft erst ermöglicht hat. In den letzten 20 Jahren hat das Land seine Produktion ausgeweitet und die Kosten für erneuerbare Energien weltweit gesenkt. In Afrika sind die Kosten pro Kilowattstunde dadurch heute 80 Prozent niedriger als vor zehn Jahren. Auch mit günstigen Elektroautos hat China einen Marktdurchbruch erzielt. Zudem investiert es mit Milliardenbeträgen in Entwicklungsländer und hat sich auf der COP29 in Baku erneut dazu verpflichtet. China ist heute unverzichtbar für die globale Energie- und Mobilitätswende.
China handelt vor allem im Eigeninteresse und erlangt erheblichen Einfluss in afrikanischen Ländern. Muss man der chinesischen Expansion nicht etwas entgegensetzen?
Jedes Land verfolgt nationale Interessen, und das sollte man ihnen nicht absprechen. Auch Deutschland hat als Exportnation ein ureigenes Interesse daran, stabile und wachsende Märkte zu fördern. Europa und die USA bieten Entwicklungsländern mit Initiativen wie Global Gateway aber auch bereits gezielt alternative Finanzierungsquellen zur chinesischen Finanzierung an. Solch ein Wettbewerb muss nicht grundsätzlich destruktiv sein, er kann auch Innovation fördern. Wichtig ist, den Wettbewerb fair zu gestalten, auf die richtigen Ziele auszurichten und uns die Fähigkeit zu erhalten, konstruktiv zusammenzuarbeiten. Um Transparenz und mehr gegenseitige Verlässlichkeit zu schaffen, könnte etwa ein klarer Kriterienkatalog helfen.
Auch Indien und die Golfstaaten sind wichtige Investoren geworden. Wie kann man mit ihnen zusammenarbeiten?
Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate investieren massiv in grüne Energietechnologien. Deshalb ist es wichtig, mit ihnen zusammen internationale Finanzinvestitionen zu gestalten und das Kreditvolumen der multilateralen Entwicklungsbanken zu erhöhen. Mit der Kapitalaufstockung der Weltbank im Dezember 2024, dem IDA21-Replenishment, ist der erste Schritt dahin gelungen.
Im Juni findet in Sevilla die vierte internationale Financing-for-Development-Konferenz (FfD) statt. Lassen Sie uns einen Blick zurück werfen: Was hat sich seit der letzten FfD-Konferenz vor zehn Jahren in Addis Abeba getan?
Zunächst gab es viel Rückenwind, und die EZ-Ausgaben gemessen in ODA-Zuschussäquivalenten sind auf über 200 Milliarden Dollar im Jahr gestiegen. Außerdem ist uns die Bedeutung des Privatsektors immer klarer geworden, und wir haben wichtige Erfolge mit grünen Anleihen auf Kapitalmärkten erzielt. Zwar haben sich die anfänglichen Hoffnungen nur bedingt bewahrheitet, in der Klimafinanzierung aber haben privatwirtschaftliche Mittel enorme Wirkung erzielt. Für 2024 werden die weltweiten Investitionen in neue Stromerzeugungsinfrastrukturen auf etwa 3 Billionen Dollar geschätzt, wovon zwei Drittel in saubere Energiequellen fließen. Doch weniger als zwei Prozent davon wurden auf dem afrikanischen Kontinent investiert, wo der Bedarf an Finanzierung und neuer Energieinfrastruktur am größten ist. Hinzu kommt die Verschuldungskrise. Während einige Länder also erfolgreich Finanzmittel mobilisieren konnten, befindet sich ein Großteil der ärmsten Länder in einer Art Rückschlagsphase.
Wieso ist es so schwierig, ausgerechnet die ärmsten Länder zu erreichen?
Arme Länder sind anfälliger für äußere Schocks und haben zugleich weniger Möglichkeiten, darauf zu reagieren. In der Coronapandemie konnten reiche Staaten durch Steuern, Anleihen oder Schulden wirtschaftliche Schocks abfedern, während ärmeren Ländern die Mittel dafür fehlten.
Für Anleihen mussten sie extrem hohe Zinsen zahlen. Durch die Verschuldungskrise geben viele arme Länder mehr für Zinsen auf internationale Schulden aus als für Bildung oder Gesundheit. Zudem fehlt es an stabilen Institutionen, Transparenz auf Kapitalmärkten und etablierten Börsen. Internationale Anleger meiden viele dieser Länder, weil sie gerade in Krisenzeiten kein Risiko eingehen möchten.
Welche Ansätze gibt es, hier dennoch zu unterstützen?
Erfolgsbeispiele aus Ostasien, China oder Lateinamerika zeigen: Wo der Staat Rahmenbedingungen wie öffentliche Stromversorgung und digitale Infrastruktur bereitstellt, können sehr schnell neue Märkte entstehen. Wir unterschätzen manchmal, wie viel EZ hier bewirken kann, etwa durch Exportkreditfinanzierung, um Risiken zu mindern und Privatkapital zu mobilisieren, oder durch Reformen für effizientere Steuersysteme. Wir haben mit UNDP und der OECD zusammen etwa das Programm „Tax Inspectors without Borders“ gestartet und beraten Länder dabei, Steuerflucht internationaler Unternehmen zu verhindern. Obwohl es nur ein kleines Programm ist, konnten bereits über 2 Milliarden Dollar Steuereinnahmen gesichert werden, die sonst nie geflossen wären.
Wenn sich wichtige Geberländer zurückziehen, was wird dann aus den ärmsten Ländern?
Das können wir bereits beobachten: Einige erleben große Rückschläge bei der Armutsbekämpfung oder der Nahrungsmittelsicherheit. Naturkatastrophen wie die Überschwemmung in Pakistan können eine Volkswirtschaft um Jahrzehnte zurückwerfen, was politische Spannungen und Extremismus fördert. Sri Lankas Staatspleite beispielsweise führte zu Massenprotesten und einer politischen Krise. Es liegt im globalen Interesse, solche Risiken zu minimieren.
Sie erwähnten, dass Sie gute Erfahrungen mit Staatsanleihen gemacht haben. Wie funktioniert das?
Wir beraten eine ganze Reihe von Ländern dabei, mit Anleihen auf den Markt zu gehen. Wegweisend waren Uruguays „Sustainability-Linked Performance Bonds“, die wir gemeinsam mit der lateinamerikanischen Entwicklungsbank begleitet haben. Das Land verpflichtete sich, CO₂-Emissionen zu senken und die Forstfläche zu erweitern. Erfolg führt zu niedrigeren Zinsen, Misserfolg zu höheren Zinsen. Der Bond wurde mit 1,5 Milliarden Dollar auf den Markt gebracht und dreifach überzeichnet – ein Modell, das inzwischen große Beachtung findet. Das zeigt: Der Markt für nachhaltige Finanzierungen wächst stetig. Voraussetzung für solch einen Ansatz ist aber eine Volkswirtschaft, die Kapital produktiv einsetzen und Rendite erzielen kann.
Ein zentrales Anliegen des FfD-Prozesses war, die nötige Finanzierung für die 17 Entwicklungsziele (SDGs) bereitzustellen. Diese werden bis 2030 wohl nicht erreicht. Sind die SDGs gescheitert?
Viele sehen das so, weil bisher nur 17 Prozent der Ziele auf Kurs sind. Dabei übersieht man aber, wie viel sich auf nationaler Ebene getan hat. Und man übersieht die Bedeutung der SDGs als Leitlinie: Die Agenda hat uns einen Rahmen gegeben – eine Orientierung, um selbst in turbulenten Zeiten gemeinsam voranzukommen.
Welche konkreten Erfolge konnten bisher erzielt werden?
Die globale Nahrungsmittelproduktion reicht für die mittlerweile 8 Milliarden Menschen auf der Welt, die Lebenserwartung steigt, und immer mehr Kinder weltweit gehen länger zur Schule. In der Region Lateinamerika und Karibik stammen heute 60 Prozent des Stroms aus sauberen Quellen – das ist doppelt so viel wie der globale Durchschnitt –, und in einigen afrikanischen Ländern liegt der Anteil sogar bei 90 Prozent. Dazu gab es immensen technologischen Wandel: 1995 hatten nur 16 Millionen Menschen Internetzugang, heute sind es fast 6 Milliarden. Eine UNDP-Studie zeigt, dass 70 Prozent der SDG-Ziele durch Digitalisierung schneller und effektiver umgesetzt werden können. Öffentliche digitale Infrastruktur ist ein zentraler Entwicklungstreiber.
Was schließen Sie daraus?
Das alles zeigt: Wir leben nicht in einem Zeitalter der Perspektivlosigkeit! Die Voraussetzungen, um große Fortschritte zu machen, waren noch nie so gut. Umso wichtiger ist es, dass die Politik jetzt mehr Ruhe in die öffentliche Diskussion bringt. Anstatt Menschen gegeneinander aufzubringen, sollte sie dafür sensibilisieren, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind – und welche Potenziale das auch birgt.
In einer sich schnell wandelnden Weltlage steht im Sommer die FfD-Konferenz in Sevilla an. Was sind Ihre Erwartungen an
das internationale Treffen?
Die Konferenz ist in erster Linie eine Chance, wieder zusammenzufinden. Dafür sind vier Dinge wichtig:
- Die Frage sollte nicht nur sein, wie viel Geld bereitgestellt wird, sondern wie wir gemeinsam in die Zukunft investieren können. Dafür müssen wohlhabende Länder anerkennen, welchen erheblichen Beitrag Entwicklungsländer bereits selbst leisten. Sie investieren ein Vielfaches dessen, was internationale Klimafinanzierung bereitstellt. Internationale Zahlungen sind keine Almosen.
- Zweitens müssen wir uns mit der prekären Situation der ärmsten Länder auseinandersetzen. Diese Staaten laufen Gefahr, immer weiter zurückzufallen.
- Drittens müssen wir einen Weg finden, wie wir private Anleger, Investoren und Finanzmärkte mehr für Inves-
titionen in Entwicklungsländern gewinnen können. Wenn die Kapitalmärkte sich zurückziehen, dann sind Milliarden von Menschen von dringend nötigen Finanzierungsmöglichkeiten ausgeschlossen. - Viertens hoffe ich, dass wir uns in Sevilla noch einmal darauf verständigen können, dass wir trotz der geopolitischen Unterschiede und Wettbewerbskonflikte miteinander kooperieren wollen.
Der neue Entwurf für das Sevilla-Abschlussdokument ist ein Versuch, inmitten der globalen tektonischen Verschiebungen einen gemeinsamen Nenner zu finden. Bei der COP29 wurde das unterschätzt: Man kann bei einer internationalen Konferenz nicht erwarten, dass sich in letzter Minute ein Kompromiss aus dem Nichts ergibt. Wenn ein Durchbruch aktuell nicht möglich ist, sollten wir zumindest Strategien entwickeln, um diesen in Zukunft zu ermöglichen. Das Ziel in Sevilla muss sein, einen konstruktiven Weg nach vorn aufzuzeigen.
Achim Steiner leitet das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP).
undp.org