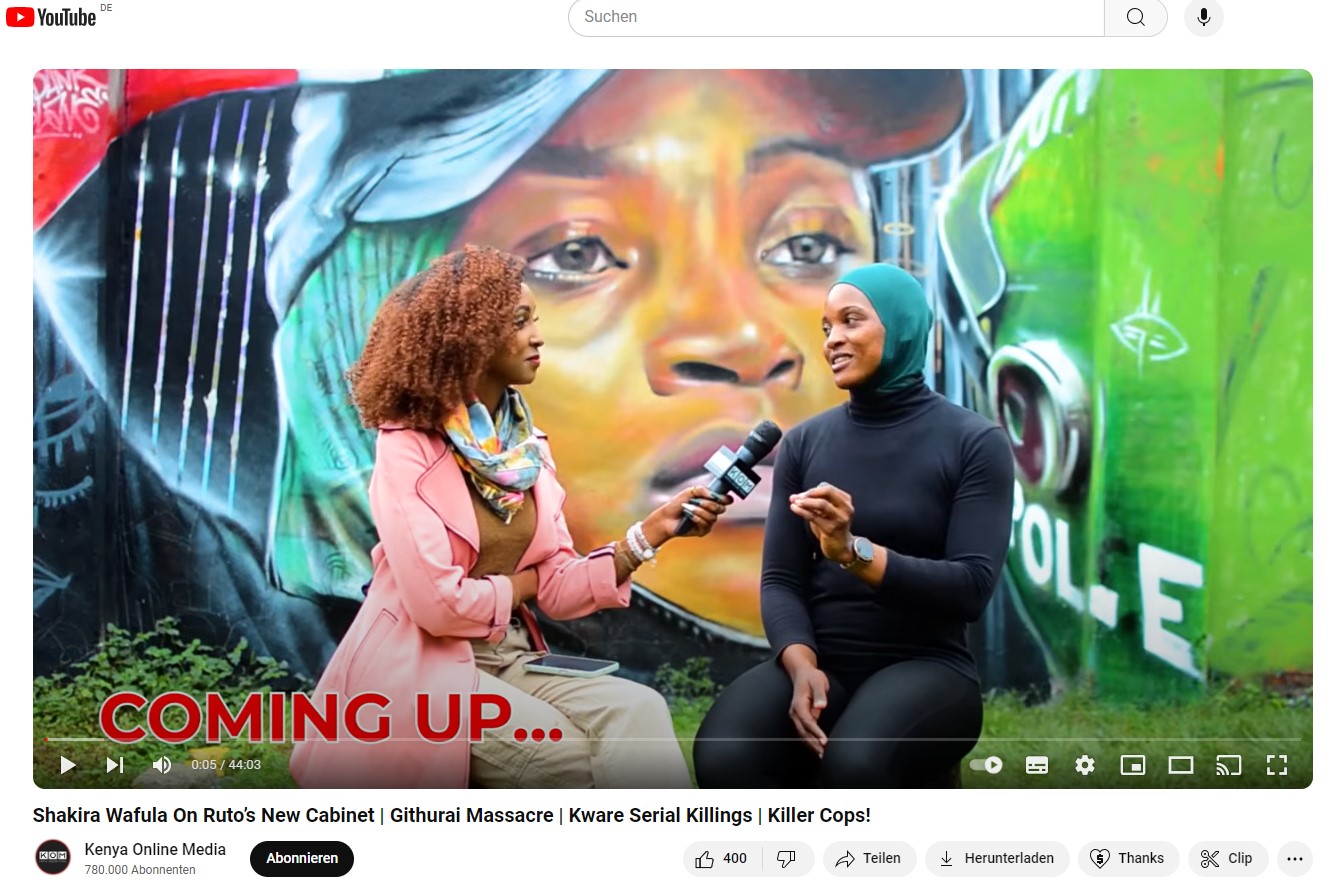Ländliche Entwicklung
Agrarpolitik muss weltweit auf lokale Stimmen hören

Wo steht es um Ernährungssicherheit besonders schlecht?
Dort, wo Kriege toben, wo Folgen des Klimawandels deutlich zu spüren sind und wo gesellschaftliche Gruppen ausgeprägte Marginalisierung erleben, was etwa den Zugang zu Land, Geld und anderen Ressourcen angeht. Ein Riesenproblem sind zudem die hohen Lebensmittelpreise. Wir beobachten, dass die Inflation in Ländern mit hohen Einkommen seit einiger Zeit zurückgeht. In Ländern mit niedrigen Einkommen ist das aber nicht so. Viele Menschen können sich schlicht nicht mehr leisten, was ihre Familien brauchen.
Ist der Grund der Preissteigerungen, dass die betroffenen Länder von Lebensmitteleinfuhren abhängen?
Die Inflation hängt damit zusammen, aber Importabhängigkeit ist nicht der einzige Grund. Relevant ist auch die Qualität von Transport- und Lagermöglichkeiten. Ernährungssicherheit ist eine vielschichtige Herausforderung, wir müssen also multikausal denken. Wichtig ist, wie Wertschöpfungsketten funktionieren. Wo Produktion, Verarbeitung und Vertrieb in örtlicher Nähe stattfinden, ist die Lage generell besser – und dort entsprechen die Preise auch normalerweise örtlichen Gegebenheiten. Das heißt, sie sind einerseits für Verbraucher erschwinglich, bieten andererseits aber den bäuerlichen Familien ein gutes Auskommen. Wesentliche Voraussetzung ist dabei immer die ländliche Infrastruktur, mit Straßen, Mobilfunkanbindung, Wasser- und Stromversorgung, aber auch Bildungseinrichtungen und einem funktionierenden Gesundheitswesen. Wo lokale Wirtschaftskreisläufe gut funktionieren, ist die Ernährungssicherheit generell besser als da, wo das nicht der Fall ist.
Bringt die Klimakrise solche Kreisläufe jetzt dort durcheinander, wo sie bisher einigermaßen funktioniert haben?
Ja, und zwar massiv. Fast jedes Land ist betroffen. Im südlichen Afrika werden zum Beispiel die Dürreperioden länger und verheerender. Simbabwe hatte früher eine recht produktive Landwirtschaft, aber die Ernten werden klimabedingt schlechter. Auch in Ostafrika gibt es seit Jahren viel zu wenig Regen. Das nimmt den Menschen buchstäblich ihre Lebensgrundlage. Dass in Kenia heftige Proteste ausgebrochen sind, als die hochverschuldete Regierung beginnen wollte, Lebensmittel zu besteuern, war eigentlich kaum überraschend. Die Leute sind an vielen Orten verzweifelt und wütend.
Sind die vom Klima beeinträchtigten Gegenden dauerhaft auf humanitäre Hilfe angewiesen?
Nein, das muss nicht sein. Es ist allerdings das falsche Signal, dass die Bundesregierung die Haushaltsmittel für die humanitäre Hilfe in der aktuellen Weltlage halbiert hat. Allein die Lage in Kriegsgebieten ist katastrophal – und dabei denke ich nicht nur an Sudan und Gaza. Es ist sehr beunruhigend, dass die Hauptakteure sich immer weniger an das humanitäre Völkerrecht gebunden fühlen. Das gilt leider auch für die Konfliktparteien in Gaza. Wir haben mit anderen Hilfswerken zusammen mehrmals, aber bisher leider erfolglos darauf hingewiesen, dass in Gaza sofort ein Waffenstillstand nötig ist. Klare Verstöße gegen humanitäre Prinzipien haben international zurzeit aber keine Konsequenzen mehr. Das belastet die Glaubwürdigkeit des Westens, was es dann Russland leicht macht, sich in Afrika zu engagieren. Offensichtlich steigt der Bedarf an humanitärer Hilfe aber auch aus anderen Gründen, und das gilt ähnlich für entwicklungspolitische Maßnahmen. Dennoch spart die Bundesregierung an diesen Stellen.
Welche Entwicklungsstrategien würden den vom Klimawandel betroffenen Regionen ermöglichen, sich weiter selbst mit Nahrungsmitteln zu versorgen?
Wir müssen resiliente Systeme aufbauen. Dafür gibt es auch gute Ansätze. Wichtig ist, dass sämtliche Beteiligten einbezogen werden; wir müssen also auch lokale Stimmen aus dem ländlichen Raum von Ländern mit niedrigen Einkommen beachten. Die agrarökologischen Systeme sind häufig fragil und unterscheiden sich von Ort zu Ort stark. Deren spezifische Bedingungen müssen beachtet werden, wenn sie resilienter werden sollen.
Welche Mittel gibt es, um die Resilienz zu stärken?
Manche Interventionen sind technisch recht einfach. Zum Beispiel können mit Solarstrom betriebene Pumpen recht große Flächen bewässern. Wesentlich ist aber vor allem, deutlich mehr in agrarökologisch nachhaltige Bodenbewirtschaftung zu investieren. Das macht die Äcker produktiver, lässt sie CO2 speichern und stärkt ihre Beständigkeit – unter anderem, weil bedeckte Böden nicht so schnell von Starkregen weggeschwemmt werden. Sinnvoll wäre es obendrein, die CO2-Speicherung zu zertifizieren, um eine zusätzliche Einkommensquelle für die Betriebe zu schaffen. Es wären viele Win-win-Situationen möglich.
Massiver Einsatz von Kunstdünger und Pestiziden ist also nicht der richtige Ansatz?
Das, was wir in Europa oder Nordamerika konventionelle Landwirtschaft nennen, ist jedenfalls nicht die einzige Lösung, auch wenn Dünger und Pestizide nicht per se verteufelt werden sollten. Auch der Einsatz schwerer Maschinen ist in tropischen und subtropischen Gegenden problematisch, weil sie die Böden stark komprimieren. Es sollten geeignete Maschinen zum Einsatz kommen. Wichtig sind auch angepasste Sorten, die besser mit Trockenheit und Überflutungen klarkommen. Entscheidend ist, Systeme so weiterzuentwickeln, wie es den örtlichen Bedingungen entspricht, und dafür ist, wie gesagt, die konsequente Einbindung aller lokalen Beteiligten wichtig, weil sie diese Bedingungen kennen.
Ist es internationaler Konsens, dass mehr auf Wünsche und Bedürfnisse der Menschen vor Ort geachtet werden muss?
Ja, es geht nur mit den Menschen und nur mit der Natur. Ich beobachte weltweit ein intensives Umdenken. Das große Thema ist, wie sich die Landwirtschaft auf die Klimakrise einstellen kann und muss. Das treibt nicht nur afrikanische Regierungen um, denen klar ist, dass sie nicht einfach die Modelle aus dem Norden kopieren können. Tiefe Reflektion findet aber auch in internationalen Institutionen wie der FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) oder dem IFPRI (International Food Policy Research Institute) statt. Das gilt gleichermaßen für bilaterale Geberorganisationen wie etwa die deutsche GIZ, mit der wir gut zusammenarbeiten. Klar ist aber auch, dass große Investitionen nötig sind – und von Geberregierungen unterstützt werden müssen.
Mathias Mogge ist Generalsekretär der Welthungerhilfe, der deutschen internationalen Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Bonn.
mathias.mogge@welthungerhilfe.de
X/Twitter: @MathiasMogge