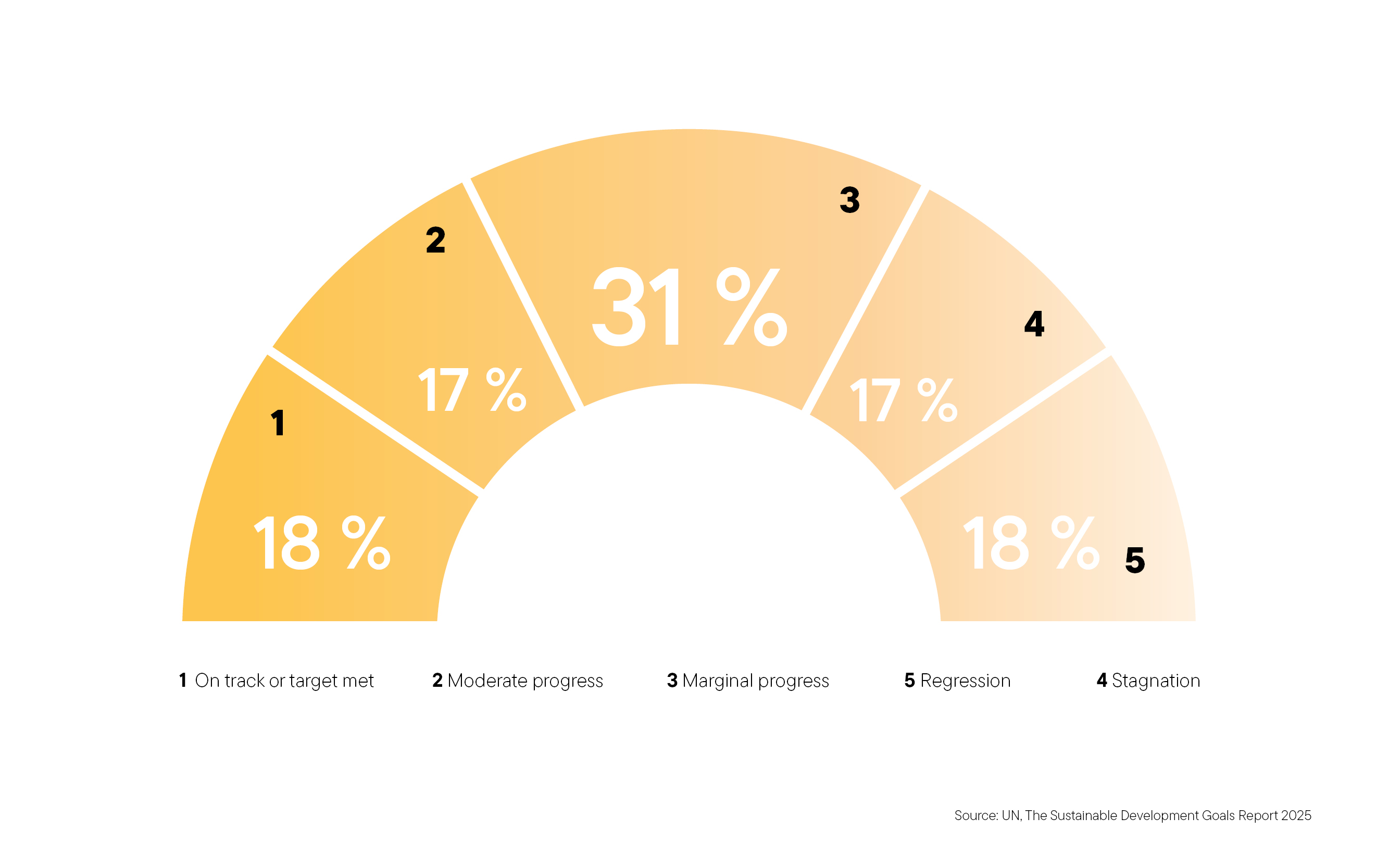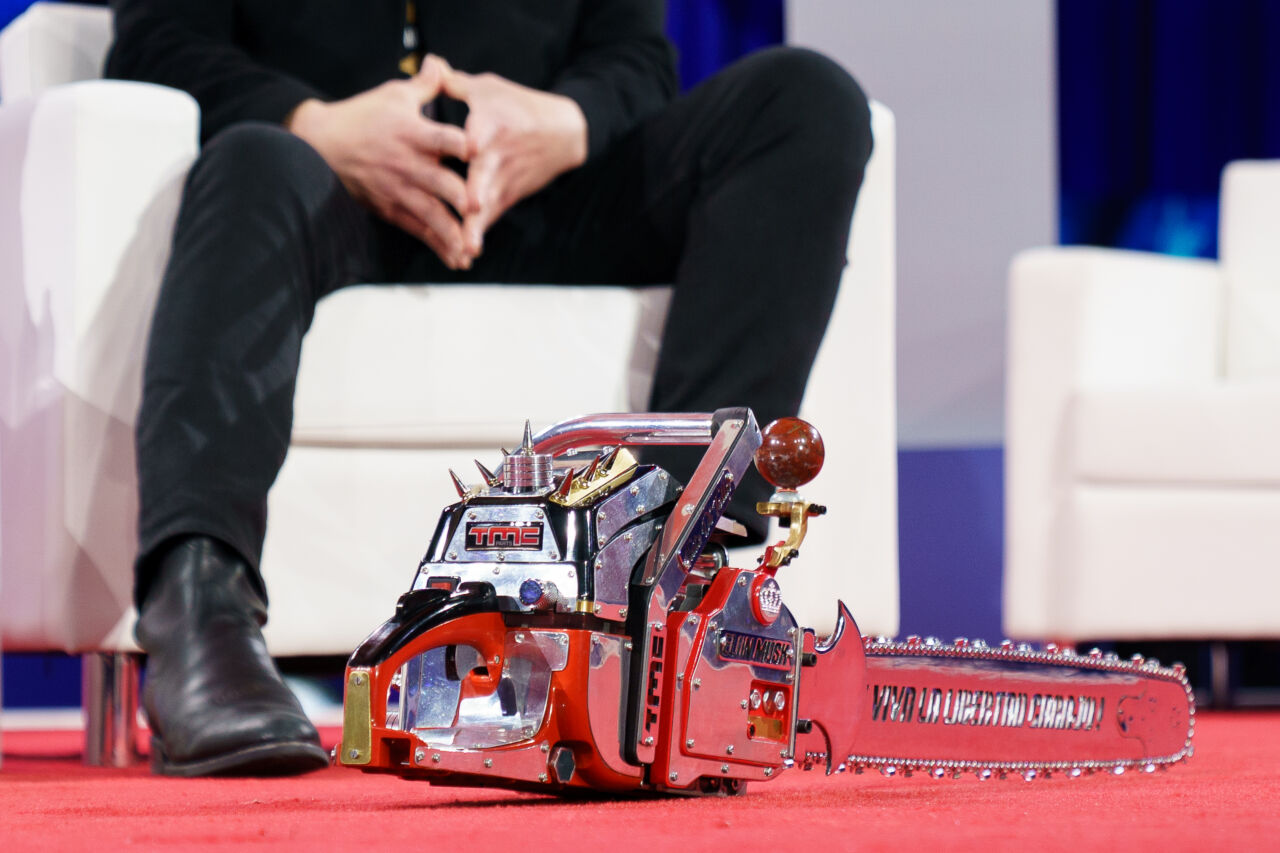Wachstum
Wie Subsahara-Afrika auf inklusive Weise wachsen kann

Im Jahr 1990 war die Hälfte der Menschen in Subsahara-Afrika, Südasien, Ostasien und im Pazifikraum extremer Armut ausgesetzt. Drei Jahrzehnte später lebten noch schätzungsweise 35 % der Bevölkerung Subsahara-Afrikas in extremer Armut – in Südasien hingegen neun Prozent und in Ostasien und im Pazifikraum noch ein Prozent. Wie kann das sein, wenn man bedenkt, dass zwischen 2000 und 2014 fast die Hälfte der 25 am schnellsten wachsenden Länder in Subsahara-Afrika lag?
Tatsächlich war das Wachstum in Subsahara-Afrika weder ausreichend noch effizient oder inklusiv genug, um die Armut maßgeblich zu reduzieren. Das Wirtschaftswachstum hat mit dem raschen Bevölkerungszuwachs nicht mitgehalten. Die extreme Armut ist zwischen 2000 und 2014 zwar um rund 20 % gesunken, aber aufgrund des rasanten Bevölkerungswachstums leben trotzdem nur zehn Millionen weniger arme Menschen in Subsahara-Afrika.
Auch scheint das Wachstum relativ wenig zur Armutsbekämpfung in Subsahara-Afrika beizutragen. Steigt das Pro-Kopf-BIP in Subsahara-Afrika um ein Prozent, so verringert sich die Armut ebenfalls nur um ein Prozent – gegenüber 2,5 Prozent weltweit. Das hängt mit der Qualität des Wachstums im Afrika südlich der Sahara zusammen: Es weist eine geringe Entwicklung des Humankapitals auf, eine geringe wirtschaftliche Diversifizierung sowie einen unzureichenden Strukturwandel.
Zudem ist Subsahara-Afrika nach Lateinamerika die Region mit der zweithöchsten Ungleichheit weltweit. Die Armutsbekämpfung in Subsahara-Afrika wird demnach deutlich mehr durch Einkommenswachstum (84 %) als durch eine gerechtere Einkommensverteilung (16 %) vorangetrieben.
Mehr als die Hälfte der Ungleichheit in Subsahara-Afrika rührt aus ungleichen Chancen aufgrund von Faktoren wie Geburtsort, ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht und familiärem Hintergrund sowie aus Unwirtschaftlichkeiten auf institutioneller Ebene und auf dem Markt. Der Zugang zu Beschäftigung und öffentlichen Dienstleistungen ist unfair und beschränkt, und das Wachstum ist somit nicht inklusiv. Dies wiederum behindert die Armutsbekämpfung.
Konflikte aufgrund wirtschaftlicher und politischer Ausgrenzung sind ein weiteres Hemmnis. Zwischen 1996 und 2022 sank der UN-Wirtschaftskommission für Afrika zufolge das jährliche Wachstum in afrikanischen Ländern, in denen weitverbreitete Gewalt herrschte, um 20 %, und ihre Werte im Human Development Index verschlechterten sich um 2,5 %. Von den weltweit in extremer Armut lebenden Menschen befinden sich derzeit 42 % in Ländern Subsahara-Afrikas, in denen Konflikte herrschen.
Regierungen müssen Verantwortung übernehmen
Die Regierungen in Subsahara-Afrika müssen dringend etwas tun, damit die Region den Kampf gegen die Armut nicht verliert. So muss etwa gegen Unwirtschaftlichkeiten bei öffentlichen Ausgaben vorgegangen werden; durch diese sind zwischen 1980 und 2013 etwa 11,3 % des BIP verloren gegangen. Wenn das gelingt, könnten die freigesetzten Ressourcen in Sektoren investiert werden, die das Wachstum inklusiver machen und die Wirtschaft widerstandsfähiger gegenüber dem Klimawandel und anderen externen Schocks, die ebenfalls Armut verursachen.
Daher ist es wichtig, das Humankapital zu priorisieren. Kinder, die heute in Subsahara-Afrika geboren werden, erreichen voraussichtlich mit 18 Jahren 40 % ihres Produktivitätspotenzials – das ist einer der weltweit niedrigsten Werte. Durch weitere Investitionen in Bildung und Gesundheit könnte die demografische Dividende der Region bis 2030 mit 11 bis 15 % zum BIP beitragen und die Zahl der in Armut lebenden Menschen um 40 bis 60 Millionen verringern.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Landwirtschaft. Nur drei Länder der Region – Burundi, Äthiopien und Mauretanien – haben von 2015 bis 2023 tatsächlich zehn Prozent ihrer gesamten öffentlichen Ausgaben für die Landwirtschaft aufgewendet, wie es afrikanische Regierungen 2003 im Rahmen des Comprehensive African Agricultural Development Programme vereinbart haben, um die Armut auf dem Kontinent zu reduzieren.
Ausgaben für die landwirtschaftliche Entwicklung sind sinnvoll, da Wachstum in diesem Sektor die Armut zwei- bis dreimal wirksamer reduziert als in anderen Bereichen. Auch können dadurch die Selbstversorgung verbessert und die Ausgaben für Lebensmittelimporte gesenkt werden. Für die ganze Region lagen diese zwischen 2018 und 2020 bei 43,6 Milliarden Dollar.
Handel, Steuern und Überweisungen
Ebenso wichtig ist es, Hürden zu beseitigen, die eine vollständige Umsetzung der Afrikanischen Kontinentalen Freihandelszone (AfCFTA) ausbremsen. Diese Initiative wurde 2012 von afrikanischen Staats- und Regierungschefs beschlossen, um den innerafrikanischen Handel anzukurbeln. Durch sie könnten die Einkommen auf dem Kontinent bis 2035 um sieben Prozent gesteigert und 40 Millionen Menschen aus extremer Armut befreit werden.
Auch offizielle internationale Überweisungen – Geldtransfers von Migrant*innen in ihr Herkunftsland – sollten gefördert werden. Durch eine zehnprozentige Steigerung der offiziellen internationalen Überweisungen im Verhältnis zum BIP kann der Anteil der in Armut lebenden Menschen um 2,9 % gesenkt werden.
Nicht zuletzt müssen die Länder der Region ihre Finanzpolitik stärker auf die Armen ausrichten, um die Ungleichheit zu verringern. Laut Weltbank zahlen ärmere Haushalte in Subsahara-Afrika im Verhältnis zu ihrem Einkommen hohe Steuern. Um das Einkommen umzuverteilen, schlägt die Bank daher vor, Mehrwertsteuerbefreiungen abzuschaffen, von denen vor allem Reiche profitieren, da die Armen meist auf informellen Märkten einkaufen. Auch Steueranreize für Unternehmen müssen reduziert und Reiche höher besteuert werden. Die Grundsteuern in den meisten afrikanischen Staaten liegen immer noch bei etwa 10 bis 20 % des Möglichen, und die meisten Länder haben noch keine Vermögen- und Erbschaftsteuern eingeführt.
Ohne gute Regierungsführung ist Armutsbekämpfung in Subsahara-Afrika fraglos unmöglich. 2013 starteten die Staats- und Regierungschefs der Afrikanischen Union die Initiative „Silencing the Guns in Africa“ („Die Waffen in Afrika zum Schweigen bringen“) und verpflichteten sich, bis 2020 alle Kriege in Afrika zu beenden. Erreichen wollten sie das durch die Bekämpfung der Ursachen von Konflikten, einschließlich wirtschaftlicher und sozialer Ungleichheiten, und indem Straflosigkeit beendet und Rechenschaftspflicht gewährleistet wird. Auch heute noch sind jedoch verschiedene Regionen Afrikas von Konflikten geplagt, die den Kontinent daran hindern, sein volles Entwicklungspotenzial zu entfalten. Gute Regierungsführung ist auch deshalb zweifellos der wichtigste Faktor für ein wirklich inklusives Wachstum in Subsahara-Afrika.
Aimé Muligo Sindayigaya ist Wirtschaftswissenschaftler mit fast 20 Jahren Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche.
sindaimy@gmail.com