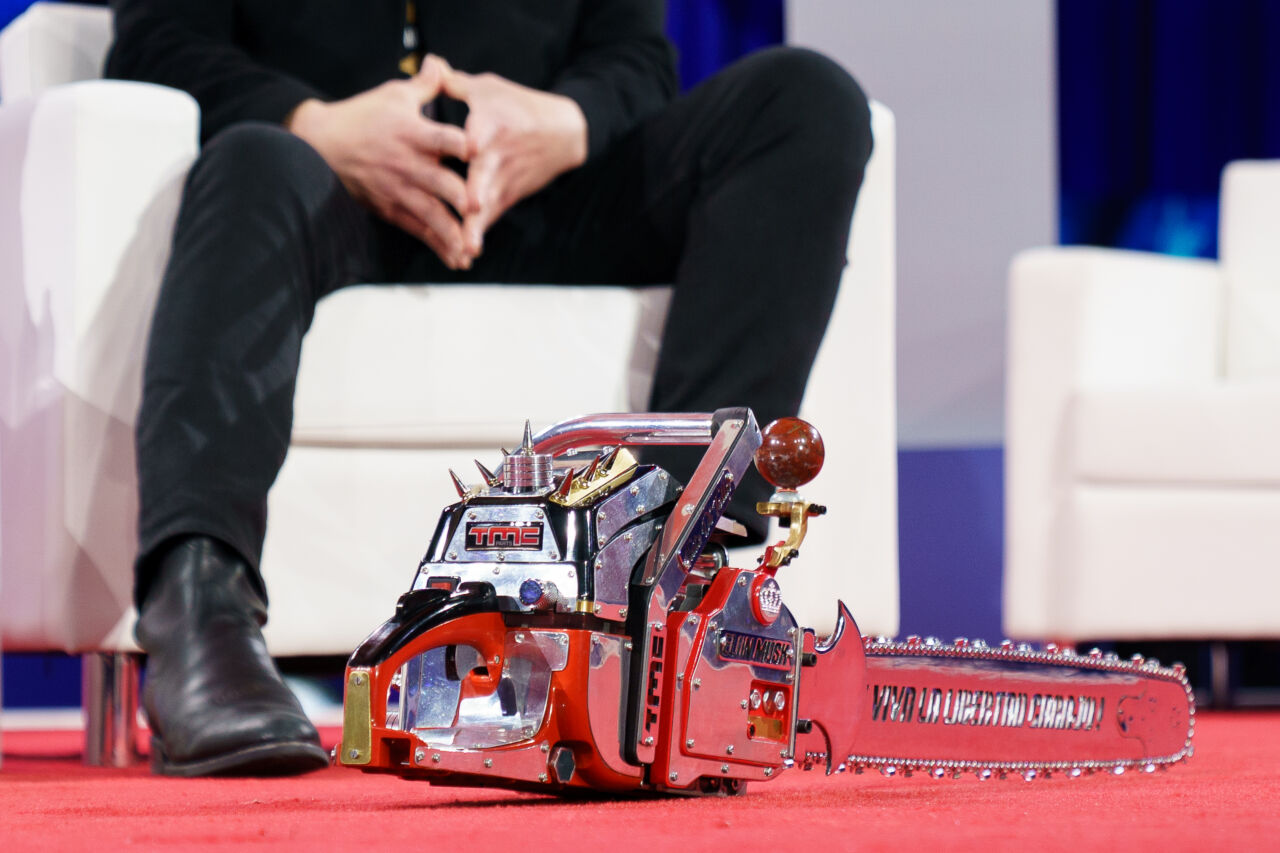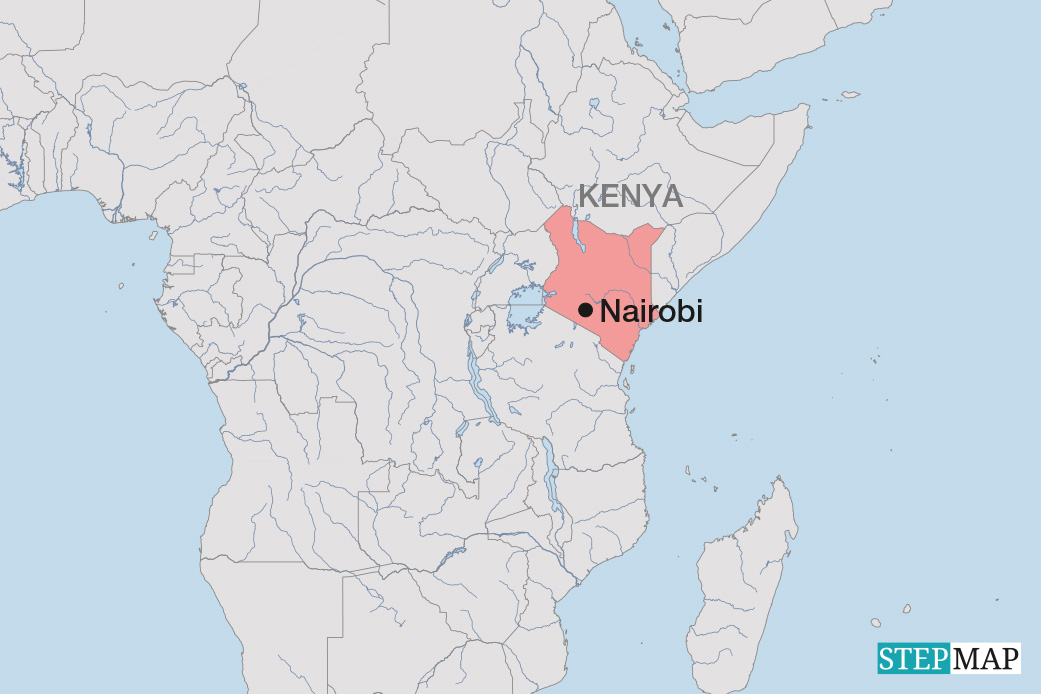Kommunikation
Lost in acronyms

Vergangenen Monat besuchte ich die CGIAR Science Week in Nairobi. CGIAR bedeutet „Consultative Group on International Agricultural Research“. Die Veranstaltung fand auf dem Gelände des UN-Komplexes statt, was der Relevanz entspricht, die die Arbeit dieser außerhalb der Fachwelt weitgehend unbekannten Organisation für die Weltgemeinschaft hat. Mehr als 9000 Menschen forschen für die CGIAR in 89 Ländern. Dabei geht es um nicht weniger als Welternährung und dauerhafte Ernährungssicherheit für alle.
Wie wichtig die Arbeit der CGIAR ist, erschließt sich nicht sofort – denn über wichtige Akteure wird nur in Akronymen gesprochen. Das gilt für die 15 großen, auf der ganzen Welt verteilten „Future Harvest Centers“, die zu zentralen Themen wie Reis, Viehhaltung oder Wasser forschen, ebenso wie für nationale Forschungsorganisationen oder universitäre landwirtschaftliche Institute. Für verschiedene Zusammensetzungen dieser Akteursgruppen, bestehende Beschlüsse und künftige Agenden gibt es weitere Abkürzungen.
So wurde auf der Science Week etwa das GNC lanciert, erarbeitet von GFAiR auf Grundlage des CGIAR-HLAP-Reports und beauftragt von verschiedenen RF wie APAARI, FARA, FORAGRO, EFARD, CACAARI und AARINENA – um die Zusammenarbeit von NARS auf der ganzen Welt zu erleichtern. Alles klar?
Gemeint ist: Das globale Forum für landwirtschaftliche Forschung (GFAiR) hat im Auftrag regionaler oder kontinentaler Foren (RF; FARA bedeutet etwa „Forum for Agricultural Research in Africa“, CACAARI ist die „Central Asia and the Caucasus Association of Agricultural Research Institutions“) ein Konsortium (GNC, das „Global NARS Consortium“) erdacht, das wiederum nationalen Forschungssystemen (NARS) dabei helfen soll, sich verstärkt auszutauschen und global zu präsentieren.
Ein weiteres Beispiel: Wenig später wurde diskutiert, wie die CGIAR die neue Zehnjahresstrategie von CAADP besser unterstützen kann. An dem Panel war eine große Runde beteiligt; es sprachen Vertreter*innen von ICRAF-CIFOR, IITA, CIAT und ILRI. Das sind Institutionen, die zum Beispiel auf tropische Regenwälder und Naturschutzgebiete spezialisiert sind (ICRAF-CIFOR), auf Landwirtschaft in tropischen Gebieten (IITA), auf Biodiversität (CIAT) oder auf Viehhaltung (ILRI). Dieser Austausch zu CAADP und CGIAR ist sehr wichtig, denn CAADP bedeutet „Comprehensive Africa Agriculture Development Programme“. Das Programm soll afrikanischen Ländern bis 2063 dabei helfen, Hunger zu beenden und Armut zu verringern, indem es die Wirtschaft durch produktivere Landwirtschaft ankurbelt.
Development Buzzwording
Auf der einen Seite ist klar: All diese Institutionen, Zusammenschlüsse und Strategien benötigen angemessene Namen, und wir Journalist*innen wollen auf keinen Fall wertvollen Platz verschwenden, indem wir jedes Mal lange Bezeichnungen ausschreiben.
Auf der anderen Seite kann die exzessive Nutzung von Akronymen verschleiern, worum es wirklich geht. In Pressemitteilungen ebenso wie in den Publikationen größerer Medienhäuser werden sie immer wieder übernommen, schlimmstenfalls ohne Erklärung. Was die dahinterstehenden Akteure konkret bezwecken oder tun, bleibt für die Lesenden oft im Dunkeln.
Akronym-Kaskaden sind weder neu noch eine Eigenheit der landwirtschaftlichen Forschung. Ich schreibe aus Kenia, wo man sich ohne Abkürzungsverzeichnis kaum im Staats- oder Bildungswesen zurechtfindet. Auch die kleinste Institution braucht Namen, die sich zu Akronymen machen lassen – was sich nicht abkürzen lässt, existiert nicht. Das gilt so auch für andere Länder des Kontinents – und natürlich ebenso für die deutsche Bürokratie.
In der Entwicklungspolitik ist Akronym-Übernutzung ein alter Hut. Die EU betreibt eine eigene Abkürzungsdatenbank, und fragt man KI nach einem typischen Satz für entwicklungspolitische Arbeit, kommt das heraus: „Im Rahmen der SDG-Agenda koordiniert das UNDP gemeinsam mit der GIZ, USAID und lokalen CSOs ein PPP-Projekt zur Förderung von WASH-Initiativen in LDCs, das durch ODA-Mittel der DAC-Geber und unter Einbindung des SWAp-Ansatzes implementiert wird. Das M&E erfolgt nach den Vorgaben des RBM und wird regelmäßig im Rahmen von JSRs und durch KPIs evaluiert.“
Erschwerend kommt hinzu: Teils bringen auch die Worte zwischen den Abkürzungen kaum Licht ins Dunkel, etwa wenn in klassischem EZ-Buzzwording die Rede ist von „strategic partnerships for impact“, „facilitation“, „capacity building“ oder „empowerment dynamics“.
Akronym-Verdrossenheit ist gerade jetzt angebracht. Angesichts drastischer Einbußen bei Forschungs- und Entwicklungsgeldern ist es wichtiger denn je, dass so viele Menschen wie möglich verstehen, was sowohl die Entwicklungspolitik als auch die Wissenschaft eigentlich leisten.
Das Beispiel der CGIAR zeigt: Selbst wichtige Arbeit, die auf die Sicherung elementarer Bedürfnisse für alle Menschen abzielt, wird oft – bestenfalls – nur von denen verstanden, die sie ausführen. Das reicht aber nicht, wenn nun neue Geber, etwa aus dem Privatsektor, mit ins Boot geholt werden müssen, um die riesigen Finanzierungslücken zu schließen. Gleichzeitig sind Initiativen wie das GNC und das CAADP in der aktuellen Lage unglaublich wichtig, da sie nationale Systeme stärken und sie weniger abhängig von der Gunst und den erratischen Entscheidungen reicherer Länder machen. Wir Medienschaffende müssen uns Mühe geben, das nötige Hintergrundwissen zu vermitteln – und es wäre sehr hilfreich, wenn die wissenschaftlichen und entwicklungspolitischen Communities ihre Botschaften klarer formulieren würden. Dass sie es nicht tun, hat vermutlich damit zu tun, dass hinter den Kulissen um Geld gekämpft wird. Dass Budgetentscheidungen dann intransparent bleiben, verschärft mittelfristig allerdings das Misstrauen der Öffentlichkeit gegenüber internationalen Organisationen und globalen Agenden.
Katharina Wilhelm Otieno ist Redakteurin bei E+Z und arbeitet zeitweise in Nairobi.
euz.editor@dandc.eu