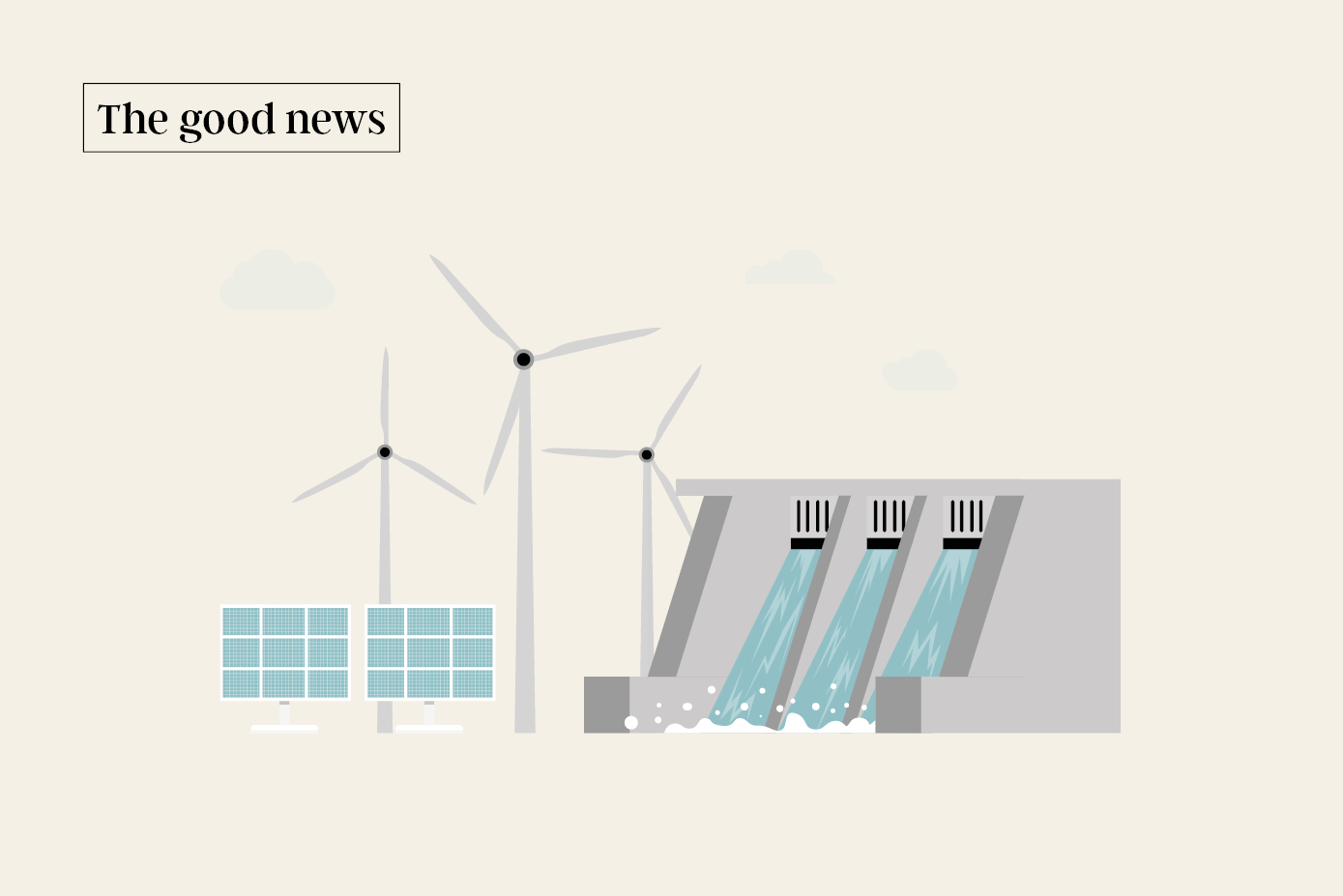Zwangsarbeit
Bessere Arbeitsbedingungen in der usbekischen Baumwollindustrie

Usbekistan ist seit Langem einer der größten Baumwollproduzenten der Welt, die Branche spielt für die Wirtschaft des Landes eine große Rolle. 2023 exportierte Usbekistan Baumwolle im Wert von 1,63 Milliarden Dollar – nach Gold ist sie damit der zweitwichtigste Exportartikel des Landes.
Die als „strategisch“ kategorisierte Baumwollindustrie war seit jeher streng staatlich überwacht. Nach Usbekistans Unabhängigkeit von der Sowjetunion 1991 zwang die Regierung die Landbevölkerung – auch Kinder – fast drei Jahrzehnte lang zur Ernte, um die staatlich vorgegebenen Baumwollquoten zu erfüllen. In der Pflücksaison von August bis Dezember mussten Schulkinder monatelang aufs Feld. So wurde ihnen Bildung vorenthalten; stattdessen waren sie ausbeuterischen Bedingungen ausgesetzt.
Menschenrechtsaktivist*innen berichteten jahrelang von weit verbreiteter Zwangsarbeit und missbräuchlichen sowie gefährlichen Arbeitsbedingungen in der usbekischen Baumwollindustrie; von unhygienischen Lebensbedingungen und schweren Verletzungen bei Erwachsenen und Kindern. Die Regierung gab Tagesquoten vor: Erwachsene mussten mindestens 60 Kilogramm ernten, jüngere Kinder etwas weniger. Lokale Behörden, Schulleiter*innen und Lehrer*innen, die keine Arbeitskräfte für die Baumwollernte bereitstellten, wurden bedroht, ihnen wurden Sozialleistungen verwehrt. Für die harte Arbeit bekamen die Baumwollpflücker*innen nur wenig Geld – viele gingen sogar leer aus.
Auch die Bäuerinnen und Bauern hatten es schwer. Die Regierung zwang sie, Baumwolle statt rentablerer Kulturen anzubauen, und legte staatliche Beschaffungspreise unter dem Marktwert dafür fest – um die Baumwolle dann auf dem Weltmarkt gewinnbringend weiterzuverkaufen. Von diesem System profitierte eine kleine Elite, während die Bauern zu kämpfen hatten.
Internationaler Boykott
Schließlich gründeten usbekische und internationale Menschenrechtsverteidiger*innen, Umweltschützer*innen und Arbeitsrechtsaktivist*innen die Baumwollkampagne (Cotton Campaign) und riefen 2009 zum Boykott usbekischer Baumwolle auf. Mehr als 330 globale Markenunternehmen unterstützten den Aufruf, darunter Adidas, H&M, Levi Strauss und Nike. Sie verpflichteten sich, keine usbekische Baumwolle zu beziehen, solange Zwangsarbeit involviert war. Der Boykott hatte drastische wirtschaftliche Folgen: Viele globale Märkte kauften keine usbekische Baumwolle mehr. Auch Regierungen und Institutionen, darunter die USA und die Europäische Union, veranlassten Restriktionen und forderten Reformen.
Der internationale Druck wirkte. Im Jahr 2014 verbot Usbekistan Kinderarbeit. Weitere Reformen folgten, und 2021 schaffte die Regierung die systematische Zwangsarbeit im Baumwollsektor ab. Ein unabhängiges Monitoring wurde eingeführt, und die Baumwollindustrie wurde teilprivatisiert, um die staatliche Kontrolle zu verringern. Die Baumwollkampagne bestätigte, dass sich die Arbeitsrechte in Usbekistan deutlich verbessert hatten, und hob im März 2022 ihren Boykott auf. Der Fall gilt als erfolgreiches Beispiel dafür, wie internationaler Druck Reformen anstoßen kann.
Druck auf Bäuerinnen und Bauern hält an
Es bleiben jedoch große Herausforderungen – und Risiken am Arbeitsplatz. „Usbekistan will nach wie vor seine marktfeindlichen Regeln für die Baumwollindustrie nicht ändern. Zentralregierung und Lokalbehörden arbeiten weiterhin nach Quote. Jede Region muss eine bestimmte Menge an Baumwolle produzieren, und Bäuerinnen und Bauern wird Land eigens für den Baumwollanbau zugewiesen“, sagt Umida Niyazova, Direktorin der in Berlin ansässigen zivilgesellschaftlichen Organisation Uzbek Forum for Human Rights.
Welcher Druck auf den Bäuerinnen und Bauern lastet, zeigte sich in einer Videokonferenz, in der der usbekische Präsidialberater Shukhrat Ganiev den Regionalbeamten drohte: „Es ist mir egal, was Sie tun, aber Sie müssen 11.000 Tonnen Baumwolle liefern. Nehmen Sie das ernst – sonst geht es für Sie und den Regionalgouverneur nicht gut aus.“
Die Regionalbehörden sind nach wie vor nicht bereit, auf Zwangsmittel zu verzichten, und setzen die Bäuerinnen und Bauern weiterhin unter Druck, die Quoten zu erfüllen – selbst, wenn sie auf vieles gar keinen Einfluss haben. Ein wichtiges Thema ist etwa der Arbeitskräftemangel in den ländlichen Gebieten Usbekistans. Wegen der niedrigen Löhne im Baumwollsektor suchen Millionen junger Männer und Frauen ihr Glück im Ausland, besonders in Russland.
Zudem ist Ackerland in Usbekistan in Staatsbesitz und wird unter restriktiven Bedingungen an Bäuerinnen und Bauern verpachtet. Die Regierung zwingt sie, Baumwolle oder Getreide anzubauen, auch wenn andere Kulturen rentabler wären. In einem kürzlich erschienenen Bericht des Usbekischen Forums für Menschenrechte heißt es, die Bäuerinnen und Bauern hätten Angst, sich den örtlichen Beamten zu widersetzen. Sie würden ungünstige Verpflichtungen hinnehmen – etwa die Zucht von Seidenraupen oder eine Senkung der Baumwollpreise – aus Angst, dass ihre Felder zerstört oder ihre Pachtverträge aufgelöst werden könnten.
Das Baumwoll-Clustersystem
Um bei der Baumwollbeschaffung weniger auf staatliche Kontrolle und mehr auf Marktorientierung zu setzen, führte Usbekistan 2017 ein Clustersystem ein. Die Kontrolle über den gesamten Produktionszyklus – Anbau, Verarbeitung und Ausfuhr – wurde privaten Textilunternehmen übergeben, den sogenannten Clustern. Dies sollte die Effizienz steigern und ausländische Investitionen anziehen.
In der Praxis hat das Clustersystem jedoch nicht die erhofften Vorteile gebracht. Statt direkt mit dem Staat zu verhandeln, schließen die Bäuerinnen und Bauern nun Verträge mit Privatunternehmen ab. Da die Regierung die Ankaufspreise aber nach wie vor unter Marktwert ansetzt, zahlen diese den Landwirt*innen wiederum weniger als ursprünglich vereinbart.
Berichten zufolge setzen bestimmte Cluster mithilfe örtlicher Behörden die Bäuerinnen und Bauern außerdem unter Druck, ihr Land herzugeben – teils durch Einschüchterungen und Drohungen. Eine Bäuerin sagte, ihr Sohn sei verprügelt und sie selbst immer wieder von der örtlichen Polizei schikaniert worden, weil sie ihr Land nicht an ein Cluster abtreten wollte.
Dass die Regierung unabhängige Baumwollgenossenschaften aufgelöst hat, hat Bedenken ausgelöst hinsichtlich des Rechts der Bauern auf Vereinigungsfreiheit und faire Marktpraktiken. Ohne Kooperativen verlieren die Bäuerinnen und Bauern Verhandlungsmacht und werden anfälliger für Ausbeutung durch regierungsnahe Cluster.
Gefahr des Rückfalls
Im November 2024 wandten sich mehr als ein Dutzend Landwirte an den usbekischen Präsidenten Shavkat Mirziyoyev. Sie forderten Reformen, um selbst entscheiden zu können, was sie anbauen, und um die Ernte dann unabhängig auf dem freien Markt verkaufen zu können. Wie die Regierung darauf reagiert, bleibt abzuwarten.
Endemische Korruption und fehlende Rechtsstaatlichkeit sind weiterhin große Probleme. Da die usbekischen Gerichte nicht komplett unabhängig sind, haben die Bäuerinnen und Bauern kaum rechtliche Möglichkeiten. Derzeit ist der Baumwollsektor de jure halbprivatisiert, aber de facto staatlich kontrolliert. Wenn die Regierung ihn nicht ernsthaft liberalisiert, besteht die Gefahr, dass die staatlichen Baumwollquoten wieder durch Zwangsarbeit erfüllt werden.
Usbekistan hat durchaus lobenswerte Fortschritte bei der Reform der Baumwollindustrie gemacht. Im Hinblick auf eine echte wirtschaftliche Liberalisierung und einen echten Schutz der Arbeitnehmerrechte besteht allerdings noch Luft nach oben. Ohne weitere Reformen könnte das Land wieder in jene Zwangspraktiken zurückfallen, die einst zum internationalen Boykott geführt haben.
Links
Baumwollkampagne (Cotton Campaign):
cottoncampaign.org/uzbekistan
Uzbek Forum for Human Rights, 2025: Uzbek Forum’s 2024 Cotton Harvest Report.
uzbekforum.org/uzbekistan-increasing-farmers-autonomy-critical-to-address-forced-labor-risks-and-attract-responsible-sourcing/
Shahida Tulaganova ist eine Produzentin, Regisseurin und Kriegsreporterin aus Usbekistan. Sie lebt in Großbritannien.
shahidayakub@gmail.com