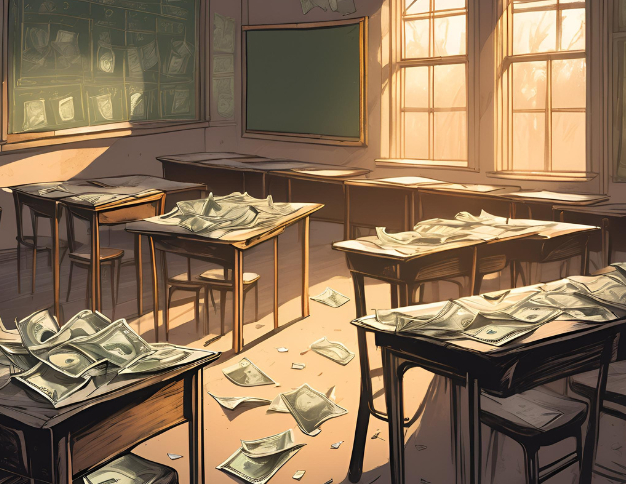Entwicklungsfinanzierung
Wie die globale Finanzarchitektur reformiert werden kann

Wenn sich diese Woche Regierungsvertreter*innen und Finanzfachleute aus aller Welt zur vierten Internationalen Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung (FfD4) treffen, sind die Ziele groß: Der Konferenzwebsite zufolge ist das Treffen eine „einmalige Gelegenheit zur Reform der Finanzierung auf allen Ebenen“, darunter der internationalen Finanzarchitektur (IFA) und der Finanzierungslücke für die SDGs. Dass es Reformbedarf gibt, darüber sind sich die meisten Expert*innen einig. Die Aufgabe ist jedoch riesig.
In einer 2024 veröffentlichten Aufsatzsammlung machen Mitglieder der entwicklungspolitischen Zivilgesellschaft, insbesondere aus dem Globalen Süden, konkrete Reformvorschläge. Herausgegeben wurde die Publikation „Building new foundations: Reimagining the International Financial Architecture“ (Neue Grundlagen schaffen: Die internationale Finanzarchitektur neu denken) vom Global Policy Forum Europe, einem Thinktank, der sich mit multilateralen Prozessen und den UN beschäftigt.
Die Autor*innen argumentieren, dass das internationale Finanzsystem wohlhabende Länder begünstige und in Entwicklungsländern den Kreislauf aus Verschuldung und Armut aufrechterhalte. Für die Bewältigung der heutigen, eng verflochtenen Krisen erweise es sich deshalb als ungeeignet. In ihren Vorschlägen nehmen sie sich die Schlüsselbereiche der IFA vor, darunter Umschuldungsmechanismen, die Sonderziehungsrechte des Internationalen Währungsfonds, Risikoprämien und globale Zusammenarbeit im Steuerbereich. Im Folgenden werfen wir einen Blick auf einige ihrer Ideen für eine gerechtere und nachhaltigere globale Finanzordnung.
Schulden neu denken: Vorschläge für gerechtere Lösungen
Die globale Schuldenkrise trifft Entwicklungsländer unverhältnismäßig stark. Maria Ron Balsera, Maria Emilia Mamberti und Matthew Forgette vom Center for Economic and Social Rights in New York argumentieren, dass Maßnahmen zur Umschuldung bislang nicht wirksam waren. Dies sei zum Teil auf einen fragmentierten und undurchsichtigen Rechtsrahmen zurückzuführen, der Gläubiger gegenüber schutzbedürftigen Nationen begünstigt.
Sie schlagen daher vor, einen unabhängigen, gesetzlichen Umschuldungsmechanismus unter der Schirmherrschaft der UN einzurichten. Die UN sind insofern ein unparteiischer Akteur, als sie weder Gläubiger sind noch eigene Interessen vertreten. Sie sollen die Schuldenrestrukturierung steuern und dabei Soft-Law-Prinzipien wie Transparenz, Gleichbehandlung und Souveränität einbeziehen. Unter anderem sollte es den Autor*innen zufolge dringend möglich sein, dass Staaten soziale Ausgaben über den Schuldendienst priorisieren. Auch ein neutraler Kreditbewertungsmechanismus gehört zu ihren Forderungen. Nicht mehr erlaubt sein sollte, dass „Geierfonds“ Schuldenkrisen für ihren Profit ausnutzen.
Auf nationaler Ebene empfehlen die Autor*innen, die Umschuldung mit Steuergerechtigkeit zu verbinden. Regierungen müssten in die Bekämpfung von Armut und Ungleichheit investieren und ihren fiskalischen Spielraum erweitern, indem sie progressiv besteuern – also höhere Einkommen stärker belasten – und Steuerflucht eindämmen.
Sonderziehungsrechte: ein schuldenfreier Weg zur Entwicklung
Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat Sonderziehungsrechte (SZR) geschaffen, die als sogenannte internationale Reserveaktiva die öffentlichen Mittel der Mitgliedstaaten ergänzen. Sie sind weder zurückzuzahlen noch an Auflagen geknüpft.
Würden in den nächsten fünf Jahren regelmäßig SZR zugeteilt, die vorrangig an Länder mit akuten wirtschaftlichen, sozialen und klimatischen Herausforderungen vergeben werden, könnte dies das Leben von Millionen Menschen nachhaltig beeinflussen, schreibt Patricia Miranda vom Lateinamerikanischen Netzwerk für wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit (Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, LATINDADD). Die derzeitige quotenbasierte SZR-Zuteilung allerdings begünstige wohlhabendere Länder. Die Autorin schlägt daher vor, stattdessen einen Vulnerabilitätsindex zu verwenden, um bedürftige Länder zu priorisieren. Dieser Ansatz würde sicherstellen, dass mehr Liquidität in die Länder fließt, die sie am dringendsten benötigen. Wenn ungenutzte SZR aus Industrieländern in Entwicklungsländer umgeleitet werden, sollte dies zudem in Form von Zuschüssen statt Darlehen geschehen, um den schuldenfreien Charakter der SZR zu wahren.
Die Autorin weist darauf hin, dass es ausreichen würde, etwa ein Viertel der von reichen Ländern gehaltenen SZR zu übertragen, um alle Schulden gegenüber dem IWF zurückzuzahlen. Sie nennt auch Beispiele dafür, wie Länder wie Argentinien, Ecuador und Paraguay SZR bereits für fiskalische Zwecke genutzt haben. Eine gerechtere, an die tatsächlichen Bedarfe der Länder gekoppelte Verteilung der SZR könne die globale Finanzierung verändern und Entwicklungsländer in die Lage versetzen, wirtschaftliche und klimatische Herausforderungen zu bewältigen, ohne ihre Verschuldung zu erhöhen.
Reform der Risikoprämien
Nach den geltenden Finanzvorschriften werden Risikoprämien als Eigentum des Kreditgebers und nicht des Kreditnehmers behandelt. Das bedeutet, dass Kreditnehmer selbst dann, wenn sie einen Kredit zurückzahlen und das Risiko sinkt, weiterhin hohe Zinsen zahlen müssen. Dies führe zu einem System, das wirtschaftlich schwächere Länder unverhältnismäßig stark belaste und gleichzeitig Kreditgeber belohne, die davon ausgehen, dass Rettungsmaßnahmen ihre risikoreichen Kredite abdecken werden: So argumentieren Oliver Pahnecke von der Middlesex University in London und Juan Pablo Bohoslavsky vom argentinischen Nationalen Rat für wissenschaftliche und technologische Forschung (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET).
Sie schlagen eine mutige Lösung vor: die Umklassifizierung von Risikoprämien als Sicherheiten, die entweder zurückgezahlt oder im Laufe der Zeit angepasst werden. Diese Reform würde die Kreditaufnahme erschwinglicher machen, das Ausfallrisiko senken und ein gerechteres globales Finanzsystem schaffen, so die Autoren. Die Angleichung der Risikoprämien an die tatsächlichen finanziellen Verhältnisse könnte Ländern helfen, aus untragbaren Schuldenzyklen auszubrechen und sicherzustellen, dass Kredite die wirtschaftliche Entwicklung unterstützen, anstatt sie zu behindern.
Ein gerechteres globales Steuersystem
Entwicklungsländer kämpfen seit Langem um einen Platz an den Verhandlungstischen der globalen Steuerpolitik. Nun soll eine von der Afrikanischen Gruppe vorangetriebene UN-Rahmenkonvention zur internationalen Zusammenarbeit in Steuerfragen gleiche Wettbewerbsbedingungen schaffen. Sie soll sicherstellen, dass die Steuerpolitik fair, transparent und auf die Bedürfnisse aller Nationen ausgerichtet ist.
Die vorgeschlagene UN-Konvention strebt eine vollständig inklusive internationale Zusammenarbeit in Steuerfragen an. Sie soll sicherstellen, dass alle Länder – nicht nur die reichsten – die globalen Steuerregeln mitgestalten können. Die Initiative zielt auf große Herausforderungen wie illegale Finanzströme, Steuervermeidung und die Besteuerung der digitalen Wirtschaft, von denen Länder mit niedrigen Einkommen überproportional betroffen sind.
Hauptziel ist es, ein Governance-System zu schaffen, das die Legitimität, Fairness und Widerstandsfähigkeit der internationalen Steuerpolitik stärkt. Erste Fortschritte seien bereits zu verzeichnen, wie Chenai Mukumba vom Tax Justice Network Africa darlegt. So hat die UN-Generalversammlung die Aufgabenbeschreibung (ToR) für eine UN-Rahmenkonvention zur internationalen Steuerzusammenarbeit verabschiedet und einen zwischenstaatlichen Ausschuss eingerichtet, der die Rahmenkonvention sowie zwei erste Protokolle ausarbeiten soll. Im Erfolgsfall könnte das UN-Rahmenwerk der Autorin zufolge die globale Steuerkooperation neu definieren.
Ein kaputtes System reparieren und Vertrauen zurückgewinnen
Zur Abkehr von einem System, in dem wohlhabende Nationen über unverhältnismäßige Macht verfügen, zählt auch eine Reform der Weltbank und des IWF. Daniel Kostzer vom Internationalen Gewerkschaftsbund (International Trade Union Confederation, ITUC) schlägt vor, von projektbezogener Hilfe zu nationalen Programmen überzugehen. Das würde sicherstellen, dass die Finanzierung mit den Prioritäten der Länder in Einklang steht. Er schlägt außerdem ein nachhaltiges Schuldenmanagement nach UN-Grundsätzen vor, bei dem der IWF zu einem Kreditgeber letzter Instanz und die Weltbank zu einem Entwicklungsfonds wird.
Eine weitere Idee ist die Sicherung neuer Finanzierungsquellen für Internationale Finanzinstitutionen (IFIs), darunter ein neu gestaltetes globales Steuersystem. So würde beispielsweise eine Finanztransaktionssteuer (FTT) – eine globale Steuer auf Finanzgeschäfte – langfristige und unabhängige Ressourcen bereitstellen. Die IFIs hätten dann Mittel zur Verfügung, die nicht von der politischen Agenda der Geberländer abhängig sind. Das Ergebnis wäre ein gerechteres, inklusiveres System, das für alle Länder funktioniert.
Auch Ohiocheoya (Ohio) Omiunu und Chioneso Samantha Kanoyangwa vom African Sovereign Debt Justice Network halten umfassende Strukturreformen beim IWF für nötig. Dass sich der IWF bisher gegen sinnvolle Reformen gewehrt hat, habe ihn soziale Legitimität gekostet. Die Stimmenverteilung begünstige die USA und andere große Volkswirtschaften, während Afrika nach wie vor deutlich unterrepräsentiert sei. Der Fokus des IWF auf Sparpolitik verschärfe insbesondere im Globalen Süden oft die wirtschaftliche Not. Beides zusammen – die Stimmenverteilung und die Sparmaßnahmen – hätte gerade im Globalen Süden zu Skepsis geführt. Auch der „gläubigerorientierte Ansatz zur Umschuldung“ des Fonds und sein Rahmen für die Bewertung der Schuldentragfähigkeit (Debt Sustainability Assessment, DSA) stehen in der Kritik.
Das Hauptargument der Autorinnen lautet: Ohne sinnvolle Veränderungen riskiert der IWF, seine Stellung als vertrauenswürdige internationale Finanzinstitution weiter zu untergraben. Sie fordern daher eine „gerechtere Machtverteilung, eine Abkehr von der Sparpolitik und eine Reform des Schuldenerlassverfahrens im Rahmen eines inklusiveren globalen Rahmens“.
LINK
Global Policy Forum Europe, 2024: Building new foundations: Reimagining the International Financial Architecture.
Roli Mahajan ist eine Journalistin aus Lucknow, Indien.
roli.mahajan@gmail.com