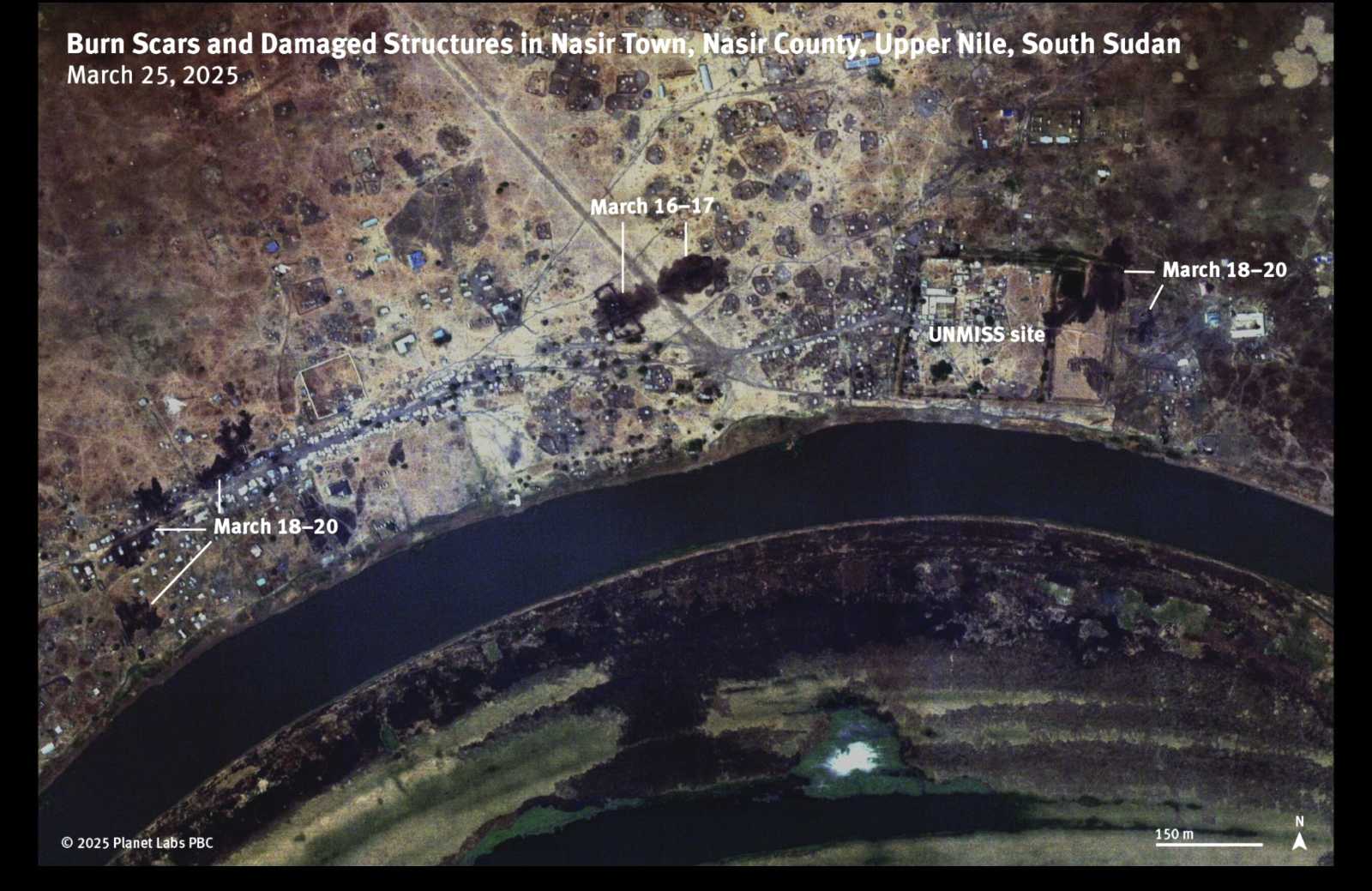Neuanfänge
Zwei Schwestern, zwei Wege

Vier Jahre ist es jetzt her, dass sich Anna und Lily Nadai das letzte Mal gesehen haben. Anna brachte ihre Schwester an den Flughafen in Nairobi, und dann hob der Flieger mit Lily in Richtung New York ab. „Das waren sehr gemischte Gefühle“, erinnert sich Anna. „Ich war traurig, weil wir noch nie wirklich getrennt waren, aber auch glücklich für sie und die Möglichkeiten, die sich ihr ab jetzt bieten würden.“
Heute telefonieren die beiden Schwestern täglich gegen den Trennungsschmerz, doch an ein Wiedersehen ist unter der aktuellen amerikanischen Regierung kaum zu denken. Bereits vor Donald Trumps Amtsantritt scheiterten sämtliche Versuche von Lily, Anna zu sich in die USA zu holen. Lilys Visum mit einer Ausreise aufs Spiel zu setzen, wollen die beiden allerdings nicht wagen. So bleibt sie sämtlichen Familienfeiern fern, die ein Wiedersehen ermöglicht hätten.
Zum ersten Mal sehen sich die beiden wohl direkt nach ihrer Geburt: Die zweieiigen Zwillinge kommen 1997 in der Kleinstadt Chukudum im heutigen Südsudan zur Welt. Anna ist zwei Stunden älter als Lily. Ihre Mutter ist die vierte Frau von Joseph Nadai, Oberhaupt der ethnischen Gruppe der Didinga und bekannter Unabhängigkeitskämpfer. Die Zwillinge haben einen weiteren Bruder und rund 30 Halbgeschwister.
In der Region, die damals politisch noch zu Sudan gehörte, herrscht seit 1983 der sogenannte Zweite Bürgerkrieg. Die SPLA (Sudanese People’s Liberation Army) kämpfte gegen Truppen der sudanesischen Zentralregierung. Das hatte historische Gründe: Im Jahr 1947 beschlossen Nordsudan und die Kolonialmacht Großbritannien, dass ersterem nach der Unabhängigkeit auch die Provinzen Südsudans zugesprochen werden würden. Südsudan war an dieser Entscheidung nicht beteiligt, und sie zog jahrzehntelange Kämpfe um mehr politische Teilhabe, Ressourcen und schließlich die Unabhängigkeit des Südens nach sich.
Friedensverhandlungen münden 2005 in der autonomen Region Südsudan. Echter Frieden hat die darauffolgende Unabhängigkeit dem jungen Land allerdings bis heute nicht gebracht: Immer wieder gibt es gewaltsame Zusammenstöße zwischen ethnischen Gruppierungen oder staatlichen Sicherheitskräften und Rebellenmilizen.
In den Bürgerkriegen Sudans sterben schätzungsweise 2,5 Millionen Menschen, etwa 4 Millionen werden vertrieben. Auch die Eltern der Zwillinge überleben diese Zeit nicht. Ihr Vater fällt 1999 einem politischen Mord zum Opfer. Im selben Jahr stirbt ihre Mutter, getötet von einer Landmine.
Flucht in der Nacht
Um Lily und Anna entbrennt ein Streit zwischen den Familien der Mutter und des Vaters. Der Vater hatte den Brautpreis für seine vierte Frau noch nicht vollends abbezahlt, und ein Teil der Familie mütterlicherseits erhofft sich, die Zwillinge später verheiraten zu können, um Kompensation zu erhalten. Dann kommt alles anders.
Viele von Annas und Lilys Halbbrüdern waren bereits zu Fuß nach Kenia geflohen. Sie drängten darauf, die beiden Schwestern nachzuholen. Nachts, im Geheimen, werden die Zwillinge über die Grenze nach Kenia geschleust – unter Mithilfe der bayerischen Nonne und Missionarin Luise Radlmeier, die während des Krieges in der Region tätig war.
Anna und Lily gelangen ins grenznahe, berüchtigte Flüchtlingslager Kakuma in Kenia. Es ist eines der größten weltweit. Aktuell leben hier rund 300.000 Geflüchtete, viele seit nunmehr 20 Jahren, darunter auch manche Verwandte und Freunde der Zwillinge.
Unter dem Schutz der Dominikanerinnen
Auch für Anna und Lily hätte Kakuma die Endstation sein können, doch Luise Radlmeier holt die beiden inzwischen Achtjährigen nach nur einem Monat nach Juja, einer Stadt in der Metropolregion Nairobi. Dort leitet sie mittlerweile eine Niederlassung des Dominikanerordens und setzt sich weiter für südsudanesische und andere Kriegsflüchtlinge ein. Sie bringt die Zwillinge in einem Waisenhaus der Dominikanerinnen unter und stellt sicher, dass sie zur Schule gehen können.
Zu Beginn fällt es den beiden Kindern schwer, sich in dem fremden Land zurechtzufinden. Sie sprachen nur Didinga, die Sprache ihrer ethnischen Gruppe. Mit der Zeit lernen sie die kenianischen Amtssprachen Englisch und Kiswahili. Dass im Waisenhaus mehr oder minder alle Kinder entwurzelt waren, habe ihre Integration und den generellen Zusammenhalt über ethnische Grenzen hinweg immens gefördert, sagen die Zwillinge rückblickend. Bis heute sind die „Waisenhaus-Geschwister“ füreinander wichtige Bezugspersonen.
Die beiden berichten, sie hätten in der Schule bisweilen Rassismus oder Diskriminierung erfahren, aufgrund ihrer Herkunft und sehr dunklen Hautfarbe. Diese Erfahrungen hätten sich aber in Grenzen gehalten. In der multiethnischen Gesellschaft Kenias – hier leben Geflüchtete oder Migrant*innen aus Burundi, Somalia, Eritrea, Nigeria und anderen Ländern – sei jeder von Zeit zu Zeit fremd, meint Anna.
Auf eigenen Beinen
Mit 20 ziehen die Schwestern aus dem Waisenhaus in eine eigene kleine Wohnung. Unterstützt von den Dominikanerinnen – die immer mal wieder verschiedene Pat*innen aus dem Westen für die Kinder in ihrer Obhut finden – und ihrer großen Familie gelingt es ihnen, zu studieren: Anna macht ihr Diplom in Kommunikationswissenschaften, Lily ihres in Öffentlichkeitsarbeit. In Kenia ist ein Diplom eine – günstigere – Vorstufe zum Bachelorabschluss.
Wie viele andere Absolvent*innen finden sie in ihren Fachgebieten zunächst keine Arbeit. Auch wenn die Gesellschaftsstruktur Kenias es Menschen verschiedener Herkunft grundsätzlich eher leicht macht, sich zu integrieren, werden auf dem hart umkämpften Arbeitsmarkt kenianische Staatsangehörige bevorzugt.
Anna und Lily halten sich mit verschiedenen Jobs über Wasser, helfen etwa Freunden in einem Klamottenladen aus, verkaufen selbst Secondhand-Kleidung online und arbeiten als Trainerinnen in einem Jugendprojekt. Anna führt eine Weile eine Bar in Juja für ihren Bruder; Lily modelt zeitweise.
Als die Covid-19-Pandemie die kenianische Wirtschaft trifft, kommen die Gelegenheitsjobs der Zwillinge zum Erliegen. Die beiden ziehen häufig um, immer gemeinsam, von einer kleinen Einzimmerwohnung in die nächste, je nach Mietlage. Beide möchten einen Bachelorabschluss machen, doch ihnen fehlt die Finanzierung. In verzweifelten Momenten spielen sie mit dem Gedanken, nach Südsudan zurückzukehren, in der Hoffnung, dort als Staatsbürgerinnen einfacher einen festen Job zu finden.
Getrennte Wege
Dann wendete sich das Blatt schlagartig für eine der beiden. Lily fand einen Partner, ebenfalls aus Südsudan, der in den USA lebte. Es gelang ihr, 2021 ein Visum zu erhalten, und die beiden Schwestern mussten sich zum ersten Mal in ihrem Leben für längere Zeit trennen.
Lily macht jetzt in einer mittelgroßen Stadt im Staat New York eine Ausbildung zur Krankenschwester. Sie besitzt eine Green Card. Offenen Rassismus habe sie in den USA noch nicht erlebt, sagt sie. Es hilft ihr, dass eine Cousine in der gleichen Stadt lebt, ebenso wie eine Freundin, die sie im Flüchtlingslager Kakuma kennengelernt hat. Weitere Mitglieder der großen Nadai-Familie leben in anderen US-Bundesstaaten. Sie zu treffen, sei schwierig, sagt Lily. Es reiche ihr aber, zu wissen, dass sie zur Not dort unterkommen könne. Auch eine Patenfamilie, die Lily und Anna früher im Waisenhaus unterstützt hat, hält den Kontakt.
Anna lebt weiterhin in Juja, doch auch sie ist vorangekommen. Ihre Brüder halfen ihr, einen Bachelor in Kommunikationswissenschaften zu finanzieren, und sie konnte in der Medienarbeit ein wenig mehr Fuß fassen – unter anderem als freie Journalistin oder mit ersten eigenen Video-Versuchen auf YouTube. Sie arbeitet fest in Teilzeit für eine gemeindebasierte Organisation und betreut benachteiligte Mädchen. Außerdem wird sie von Lily finanziell unterstützt.
In die Gesellschaft der Stadt ist Anna fest integriert, sie hat einen großen Freundeskreis und mit ihren verschiedenen Projekten oft alle Hände voll zu tun. „Juja ist meine Heimat geworden“, sagt sie.
Was bei beiden Zwillingen bleibt, ist der Schmerz der Trennung. „Dass wir jeden Tag sprechen können, macht es einfacher“, sagt Lily. „Und dass ich Anna dadurch, dass ich hier bin, helfen kann, tröstet mich auch.“ Ihre Verwandten möchte sie unbedingt weiterhin unterstützen und es auch deshalb selbst zu etwas bringen. Das erscheint ihr in den USA leichter als in Kenia. Gleichzeitig ist ihr das ostafrikanische Land weiterhin vertrauter, sie nennt das Leben dort „angenehmer“.
Zukunftspläne
Anna wünscht sich vor allem, dass Lily es vielleicht doch schafft, sie zu ihrer Abschlussfeier im kommenden Jahr in Kenia zu besuchen. Am liebsten würde sie zu ihr und den anderen Verwandten in die USA ziehen, auch Europa könnte sie sich vorstellen. „Hauptsache, ich habe die Möglichkeit zu arbeiten und Geld zu verdienen“, sagt sie.
Das sei ihr auch wichtig wegen etwas, was die Schwestern „black tax“ nennen: „Meine Brüder und Lily haben mich immer unterstützt“, sagt Anna. „Ich muss bald auch in der Lage sein, weiteren Mitgliedern meiner riesigen Familie helfen zu können – das ist eine Art Familiensteuer.“
Nach Südsudan sind Anna und Lily nur einmal zurückgekehrt, als die Gebeine ihres Vaters in einer Zeremonie erneut beerdigt wurden. Das war 2011. „Wäre das Land friedlich und stabil“, sagt Anna, „könnte ich mir einen Neuanfang dort vorstellen.“
Lily dagegen sagt, sie spüre keine tiefe Verbindung mehr zu der Region, in der alles begonnen hat. „Im Moment käme nur ein Besuch infrage“, sagt sie. „Mehr nicht.“
Katharina Wilhelm Otieno ist Redakteurin bei E+Z und arbeitet zeitweise in Nairobi.
euz.editor@dandc.eu