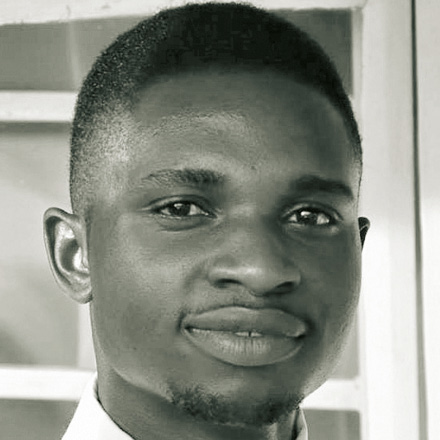Afrika
Streit ums Wasser

Als Ende des 19. Jahrhunderts die kolonialen Grenzen in Afrika festgelegt wurden, zogen die Imperialmächte sie entweder mit dem Lineal oder orientierten sich am Verlauf von Flüssen und Seen. Die meisten Grenzen haben bis heute Bestand. Da die kolonialen Karten ungenau sind, bestehen jedoch viele Unklarheiten, wo die Trennlinien genau verlaufen.
Wie komplex die Interessenlage an grenzüberschreitenden Flüssen sein kann, zeigt sich gegenwärtig am Fluss Omo, der in Äthiopien entspringt und nach 760 Kilometern in den kenianischen Turkanasee fließt. Das Weiterbestehen des Sees hängt weitgehend vom Zufluss des Omo-Wassers ab. Der Wasserspiegel ist in den letzten Jahren gesunken, weil die Bewässerungslandwirtschaft ausgebaut wurde und mehr Wasser infolge des Klimawandels verdunstet.
Umso mehr beunruhigt die Menschen am Turkanasee, dass ihr Nachbarland Äthiopien am Oberlauf des Omo zusätzlich zu den bestehenden kleineren Staudämmen den 240 Meter hohen Damm Gibe III errichten will. Die Verdunstung beträchtlicher Wassermengen im über 200 Quadratkilometer großen Stausee und die Nutzung eines Teils des aufgestauten Wassers für die äthiopische Bewässerungslandwirtschaft werden unweigerlich dazu führen, dass sehr viel weniger Flusswasser im Turkanasee ankommt. Die Weltbank und die Afrikanische Entwicklungsbank haben deshalb die Unterstützung dieses Vorhabens abgelehnt – und dabei auch vor negativen ökologischen und sozialen Folgen für Äthiopien selbst gewarnt.
Gebaut werden soll der Staudamm trotzdem – nun mit chinesischer Unterstützung und Finanzierung. Die Haltung der kenianischen Regierung zu diesem Vorhaben ist ambivalent. Einerseits lösen die ökologischen Folgen Besorgnis aus, andererseits wurde ein Vertrag mit Äthiopien über die Lieferung großer Mengen Elektrizität geschlossen, um die Energieengpässe Kenias zu vermindern. Liefern kann Äthiopien diesen Strom aber nur, wenn ihn die Turbinen von Gibe III erzeugen.
Gegen das Projekt wehren sich soziale Bewegungen und Umweltgruppen in beiden betroffenen Ländern. Aber es sieht nicht danach aus, als wenn sie sich gegen die massiven wirtschaftlichen Interessen an diesem Projekt durchsetzen könnten.
Der Nil ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Konfliktpotenzial entstehen kann, wenn mehrere Anrainerstaaten eines Flusses unter akutem Wassermangel leiden. Der Nil und seine zahlreichen Zuflüsse durchqueren elf afrikanische Länder von Tansania bis Ägypten. Da Ägyptens Wasserversorgung zu über 90 Prozent vom Nil abhängt, betrachtet man dort mit Sorge, dass Länder wie Äthiopien vermehrt Nilwasser nutzen, um die eigene Agrarproduktion zu steigern und eine wachsende Bevölkerung mit Trinkwasser zu versorgen.
Ägypten beruft sich auf Verträge von 1929 und 1959, in denen dem Land der größte Teil des Nilwassers zugesprochen wird. An den Vertragsabschlüssen waren damals aber nur Ägypten und der Sudan beteiligt. Die übrigen Staaten sehen sich daran nicht gebunden.
Internationale Kooperation kann solche Konflikte entschärfen. Zu den relevanten Maßnahmen gehören dabei:
- der Übergang zu effizienteren Formen der Bewässerungslandwirtschaft,
- die Förderung eines nachhaltigen Regenfeldbaus,
- der Verzicht auf den Anbau besonders wasserintensiver landwirtschaftlicher Kulturen,
- Wassersparmaßnahmen in den Städten und der Industrie sowie
- ein verantwortungsbewusster Umgang mit Abwässern, um eine Verunreinigung von Grund- und Flusswasser zu vermeiden.
Dafür ist offensichtlich vertrauensvolle zwischenstaatliche Zusammenarbeit nötig, wie es sie in der „Nile Basin Initiative“ gibt. Seit 1999 arbeiten zehn Länder am Nil zusammen, um die Wasserressourcen des Flusses zu verwalten. Die Kooperation bekommt, wie einige weitere ähnliche Projekte in Afrika, entwicklungspolitische Unterstützung aus Deutschland (siehe Kasten). Der Problemdruck darf allerdings nicht unterschätzt werden.
Konflikte um Seen
Nicht nur Flüsse, sondern auch mehrere große Seen in Afrika haben zwei oder mehr Anrainerstaaten. Angesichts der Bedeutung dieser Seen für die Ernährungssicherung und die wirtschaftliche Entwicklung der Länder sind Fragen der Nutzung des Wassers und der Grenzziehung auf den Gewässern sehr heikel.
Ein aktuelles Beispiel dafür ist der Konflikt zwischen Tansania und Malawi um den Grenzverlauf im nördlichen Teil des Nyassasees. Nach der kolonialen Grenzziehung steht die gesamte nördliche Seefläche Malawi in der Nachfolge der Kolonie Nyassaland zu. Tansania beruft sich aber auf das UN-Seerechtsübereinkommen von 1982, nach dem jeweils die Mitte eines internationalen Gewässers die Grenze bildet.
Bisher gelang keine einvernehmliche Regelung der Grenzfrage. Malawi bezeichnet das Gewässer mittlerweile als Malawisee und unterstreicht damit seine Ansprüche. Der Konflikt hat sich verschärft, als Malawi 2011 und 2012 im umstrittenen Seegebiet Konzessionen für die Suche nach Öl und Gas an internationale Unternehmen vergab.
Ende 2012 verständigten sich die Konfliktparteien darauf, das Afrika-Forum, das aus früheren afrikanischen Präsidenten besteht, um eine Vermittlung zu bitten. Anfang April 2013 kündigte Malawi diese Vereinbarung auf und hat stattdessen den Internationalen Gerichtshof angerufen. Opfer dieses zeitraubenden Prozesses sind vor allem die Fischer beider Länder, die nicht wissen, wo sie noch ungehindert ihre Netze auswerfen dürfen.
Zwischenstaatliche Konflikte hat es auch am Tschadsee gegeben, der anteilig zu Nigeria, Kamerun, Niger und Tschad gehört. Deutlich verminderte Zuflüsse, höhere Verdunstung wegen des Treibhauseffekts und expandierende Bewässerungslandwirtschaft haben bewirkt, dass die Fläche des Sees in den letzten Jahrzehnten um mehr als 90 Prozent geschrumpft ist.
Als sich nigerianische Bauern auf neu trocken gewordenem Land niederließen, das früher zur kamerunischen Seefläche gehört hatte, rief Kamerun den Internationalen Gerichtshof an und bekam 2002 recht. Die nigerianischen Siedler mussten die neu gegründeten Dörfer räumen. Im Rahmen der „Lake Chad Basin Commission“ arbeiten die vier Anrainerstaaten inzwischen konstruktiv zur Erhaltung des Sees und der Uferzonen zusammen.
Einige tausend Kilometer entfernt lassen die Folgen des sinkenden Wasserspiegels des Viktoriasees Konflikte entstehen. Verbrauch in der Landwirtschaft und Verdunstung gehören wieder zu den Hauptgründen. Aus der Sicht von Kenia und Tansania kommt erschwerend hinzu, dass Uganda sehr viel Wasser durch die Turbinen seiner beiden Wasserkraftwerke Owen Falls und Bujagali am Ausfluss des Sees in den Nil strömen lässt.
Früher regulierten Stromschnellen die Menge des abfließenden Wassers aus dem See. Seit es die beiden Wasserkraftwerke gibt, sieht Uganda sich dem Verdacht ausgesetzt, zu viel Wasser abfließen zu lassen, um dringend benötigte Elektrizität zu erzeugen. Andererseits können bei niedrigem Wasserstand des Sees die Fährschiffe die Anleger nicht mehr erreichen und die Fische nicht mehr ihre Laichgebiete. Hier entwickelt sich ein komplexer Interessenkonflikt, der schwer zu lösen sein wird.
Positive Beispiele
Erfreulicherweise gibt es aber viele Beispiele dafür, wie Flüsse und Seen in Afrika die Nachbarländer verbinden. Einen dieser positiven Fälle findet man am Okavango. Angola, wo der Fluss entspringt, Namibia, wo er an der Grenze entlang fließt, und Botswana, wo er nach mehr als 1300 Kilometern in der Wüste „mündet“ und versiegt, haben 1994 die „Permanent Okavango River Basin Water Commission“ gegründet. Gemeinsam übernehmen sie Verantwortung über die nachhaltige Nutzung des Flusses und seines Wassers.
Das Okavangodelta gehört zu den ökologisch vielfältigsten Regionen Afrikas, wo etwa 1300 Pflanzen- und 70 Fischarten zu Hause sind. Ohne das fragile Gleichgewicht von einströmendem Flusswasser und dem Wasserverlust durch Verdunstung und Versickerung wäre mit einer raschen Austrocknung des Deltas zu rechnen. Es ist absehbar, dass das Ökosystem durch steigende Temperaturen und vermehrte Wetterextreme in Mitleidenschaft gezogen wird. Umso erfreulicher ist, dass eine umsichtige Politik verhindert, dass der Wasserzufluss drastisch abnimmt.
Auch die afrikanischen Küstengewässer bedürfen des Schutzes, weil sie durch Umweltverschmutzung und Überfischung geschädigt werden. Erfreulicherweise haben dieses Jahr Südafrika, Namibia und Angola einen überzeugenden Beweis für gemeinsames verantwortungsbewusstes Handeln geliefert. Sie unterzeichneten am 18. März 2013 die „Benguela Current Convention“.
Der „Benguela Current“ (Benguelastrom) ist eine kalte Meeresströmung, die vom Kap der Guten Hoffnung entlang den Küsten von Namibia und Angola durch den Südatlantik fließt. Das Zusammentreffen des Benguelastroms mit warmem Meerwasser aus tropischen Zonen lässt ein ökologisch wichtiges Ozeangebiet entstehen. Es ist zugleich eine Region, in der Offshore-Ölförderung vor Angola, Diamantengewinnung in namibischen Küstenzonen sowie Schifffahrt und Fischerei beträchtliche ökologische Schäden nach sich ziehen. Eine neu gegründete, länderübergreifende Kommission hat das Mandat zur Förderung des langfristigen Schutzes, der Wiederherstellung, der Verbesserung und der nachhaltigen Nutzung des Meeresgebietes. Vorgesehene Instrumente sind unter anderem die Harmonisierung von Gesetzen und die gemeinsame Überwachung des Fischfangs.
Der Abschluss des Vertrages ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil es für die beteiligten Länder um viel geht. So hängen 98 Prozent der Regierungseinnahmen Angolas vom Öl- und Gasexport ab, wobei die Förderung vor allem an den Küsten und in den Küstengewässern erfolgt. Umweltauflagen können für alle drei Staaten gravierende ökonomische Konsequenzen haben, und entsprechend sensibel sind sie, wenn es darum geht, ein zwischenstaatliches Gremium relevante Entscheidungen fällen zu lassen.
Frank Kürschner-Pelkmann ist freier Journalist und hat sich auf internationale Wasserthemen und ökologische Fragen spezialisiert.
frank.kuerschner-pelkmann@t-online.de