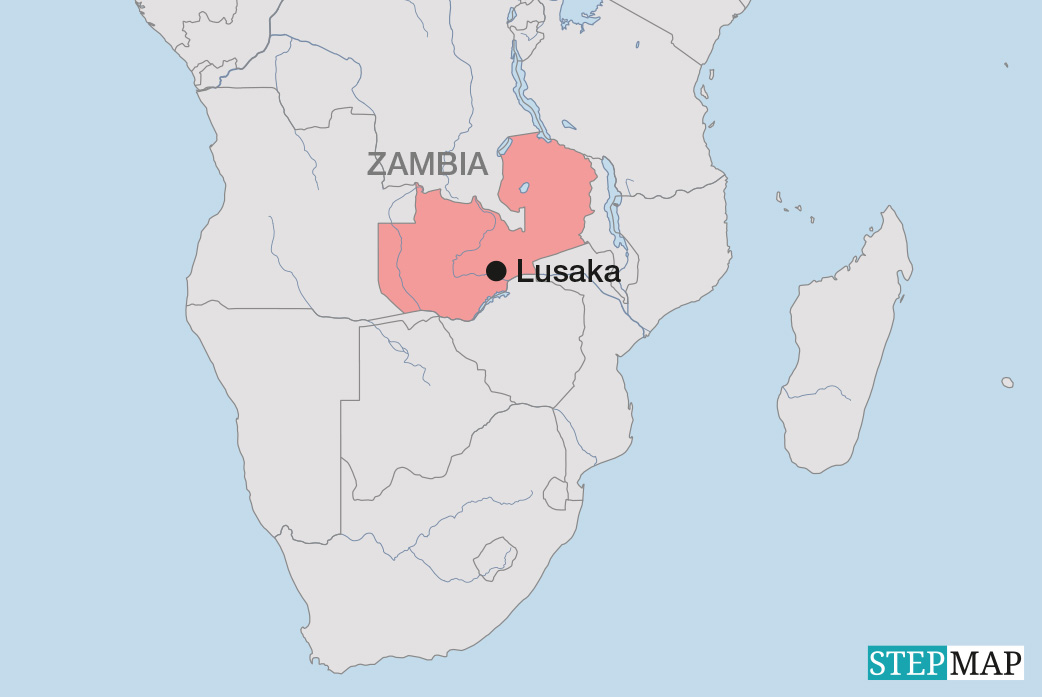Armutsbekämpfung
Besserer Marktzugang für einkommensschwache Gruppen

Amara Agossou (Name geändert) lebt in einem Dorf in Benin in bescheidenen Verhältnissen und stellt dort selbst Mangokonfitüre her. Gern möchte sie ihre Konfitüre auch außerhalb des Dorfes verkaufen – allerdings steht sie vor einigen Herausforderungen: Erstens kann sie aufgrund begrenzter Produktionsmittel nur wenig Konfitüre herstellen. Zweitens fehlt ihr ein Transportmittel, um die Ware zeitnah und sicher auszuliefern, etwa ein Zweirad mit Trägervorrichtung. Drittens kennt sie zwar einige der naheliegenden Märkte, weiß aber nicht genau, wo sie ihr Produkt am lukrativsten verkaufen kann. Sie weiß auch nicht, welche Händler*innen in der nächstgrößeren Stadt die Konfitüre in ihren Geschäften ausstellen würden und zu welchen Konditionen. All das schränkt ihre Möglichkeiten ein, auf dem Markt Fuß zu fassen und ihre Geschäftsidee auszubauen.
Wie Amara Agossou ergeht es vielen, die in kleinerem oder größerem Maßstab Waren produzieren oder weiterverarbeiten. Um diese Akteur*innen besser in lokale Märkte zu integrieren, bietet sich der Ansatz der Marktsystementwicklung (MSD – Market Systems Development) an. MSD-Projekte, die als Begleiter systemischer Veränderungen in dysfunktionalen Märkten agieren, gibt es schon seit geraumer Zeit; teils werden sie auch mit M4P abgekürzt, das steht für „Making markets work for the poor“. Ihr übergeordnetes Ziel besteht darin, Wirtschaftswachstum auf breiter Basis zu schaffen, insbesondere für Menschen mit sehr niedrigem Einkommen (Pro-Poor Growth).
MSD-Projekte analysieren zunächst den Markt in Hinblick auf Entwicklungsdefizite und Trends. Erst dann geht es darum, Maßnahmen zu priorisieren, die das beste Potenzial haben, den Zugang für marginalisierte Akteur*innen zu verbessern. Grundsätzlich sollen möglichst viele Teilnehmer*innen vom Projekt profitieren und gute Praktiken übernehmen. Erfolgreiche Projekte ermöglichen einen nachhaltigen Wandel; das heißt, sie verändern Marktsysteme so, dass diese auch ohne anhaltende oder erneute Interventionen besser funktionieren als zuvor.
MSD-Projekte sind langfristig angelegt und bestehen aus verschiedenen Phasen. In der Einführungsphase beispielsweise rekrutiert die Durchführungsorganisation das zukünftige Projektteam, und die Projektabläufe werden entwickelt und eingerichtet. Häufig ist es dann nötig, Grundlagenstudien zu erstellen. Ziel ist es, Blockaden im Markt zu identifizieren und Informationen zu den Interessengruppen einzuholen und zu analysieren.
In der darauffolgenden Umsetzungsphase werden die vom Projektteam erstellten Aktionspläne relevant. Ein wesentliches Ziel ist der verbesserte Zugang marginalisierter Akteur*innen zum Markt; nun werden beispielsweise Maßnahmen umgesetzt, die die Zusammenarbeit zwischen Produzent*innen und Transportdienstleistern optimieren oder Zielgruppen darin fortbilden, Produkte gemäß standardisierter Qualitätsanforderungen zu bearbeiten. In dieser Phase bietet es sich an, Persönlichkeiten oder Unternehmen einzubinden, die für den Markt aufgrund ihres Erfolgs Vorbildcharakter besitzen.
Erfahrungen aus Togo und Benin
Von 2014 bis 2017 verantwortete der Autor ein Regionalprogramm in Togo und Benin, das Projekte im Rahmen des MSD-Ansatzes förderte. Das Programm unterstützte unter anderem Projekte von Partnerorganisationen zu den Wertschöpfungsketten von Paddyreis und Parboiled-Reis, Maniok, Tomaten, Hühnerfleisch und traditionell hergestelltem Palmöl. Zu den wichtigsten Zielgruppen zählten Produzent*innen und Verarbeiter*innen aus einkommensschwachen Familien. Eine in Lomé ansässige zivilgesellschaftliche Organisation fungierte als Regionalkoordination.
Wie der MSD-Ansatz helfen kann, Blockaden im Markt zu lösen und Win-win-Situationen zu schaffen, zeigt ein Beispiel aus Südbenin. Dort unterstützte ein MSD-Projekt etwa 2600 Hühnerzüchter*innen. Um die tierärztliche Versorgung zu verbessern, bekamen 50 Personen eine Weiterbildung zu Veterinärassistent*innen sowie einen entsprechenden Starterkit. Sie wurden für ihre Arbeit von den Züchter*innen entlohnt und konnten so ihr Einkommen aufbessern. Zugleich löste diese neu geschaffene Gruppe von Marktakteur*innen eine Entwicklungsblockade im System: die tiermedizinische Unterversorgung in der Projektzone.
In den verschiedenen Projekten in Togo und Benin waren teils umfassende Grundlagenstudien nötig, um eine belastbare Datenbasis zu den Märkten zu schaffen. Zudem zeigte sich, dass sich die tatsächliche Größe der Zielgruppe im Laufe eines Projekts verändern kann, da es zuweilen schwer war, bereits zu Beginn alle relevanten Akteur*innen zu erfassen.
Einige weitere Erkenntnisse aus den MSD-Projekten waren zudem:
- Weiterbildungen für Mitarbeitende der umsetzenden Organisationen zahlen sich aus: Sie sollten moderieren, vernetzen und coachen können, um die Marktakteur*innen etwa dabei zu unterstützen, Arbeitstreffen selbstständig zu organisieren.
- Wissen und Erfahrungen zu sichern, ist wichtig: So lassen sich Fortschritt und Wirksamkeit eines Projekts messen und Fehlentwicklungen korrigieren. Zudem können spätere Projektphasen davon profitieren. Mit Schulungsbedarf in diesem Bereich ist daher zu rechnen.
- Falsche Erwartungen gilt es zu vermeiden: Projektträgern und Zielgruppen muss von vornherein klar sein, dass MSD-Projekte nicht mit großen Zuschüssen arbeiten. Kleinere, gezielte Anreize für bestimmte Marktteilnehmer*innen lösen aber Blockaden und können die Gesamtsituation zum Teil drastisch verbessern.
- Soziale Normen können dem Aufbau des anvisierten Marktes entgegenstehen: Dazu zählen traditionelle Geschlechterrollen, die Frauen daran hindern, durch Unternehmertum finanziell unabhängig zu werden. Solche Hindernisse mit dem Projekt zu umschiffen, kann kompliziert und langwierig sein.
- Die Zusammenarbeit mit staatlichen Behörden hat Vor- und Nachteile: Sie können zwar ab einem gewissen Punkt große Hebelwirkung entfalten, agieren aber tendenziell eher zu langsam im Sinne der Projektlogik.
Unterm Strich können MSD-Vorhaben „Game Changer“ sein und strukturschwache Märkte zugunsten marginalisierter Gruppen verändern. Der technische und finanzielle Begleitungsaufwand ist aber nicht zu unterschätzen. Weitere Informationen zum Thema gibt unter anderem das Springfield Centre mit Sitz im Vereinigten Königreich, das federführend in der Entwicklung und Dokumentation von MSD-Projekten ist.
Links
Springfield Centre:
springfieldcentre.com
Bekkers, H. und Zulfiqar, M., 2020: The story of MSD: achieving sustainable development at scale.
beamexchange.org/resources/1353/
Arndt R. Brodkorb ist diplomierter Landschaftsökologe, zertifizierter systemischer Coach und Gründer der Beratungs- und Coaching-Agentur A-DEQUAT, die in Ziguinchor (Senegal) ansässig ist.
a.brodkorb@a-dequat.org