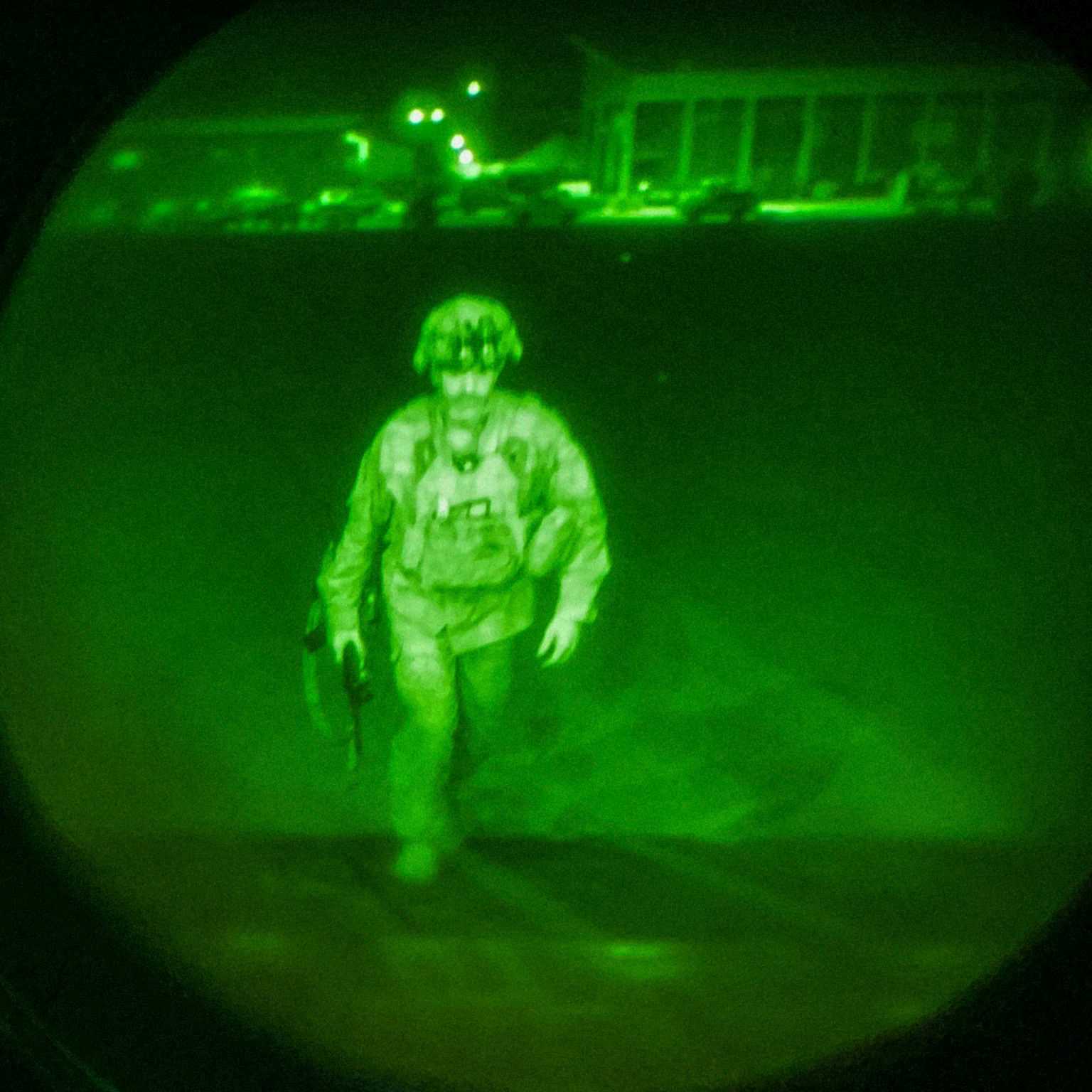Machtwechsel
Neue Besen kehren im Süden Afrikas

Nach 38 Jahren an der Staatsspitze machte Angolas Präsident Eduardo dos Santos den Weg frei für einen Jüngeren – aus Gesundheitsgründen. Seit September lenkt João Lourenço, Jahrgang 1954, die Amtsgeschäfte. Ihm haftet der seltene Ruf eines integren Politikers an, dessen Lebensstil nicht dem obszönen Luxus der „Öligarchie“ frönt. Er soll für neues Vertrauen in die MPLA-Regierung sorgen. Deren Glaubwürdigkeit litt schon lange innerhalb der Bevölkerung, die vom Ölboom außer steigenden Lebenshaltungskosten nie etwas hatte. Trotz massiver Repressionen gab es immer mehr Protestaktionen gegen das Regime. So wurde ein Wechsel immer dringlicher – zumal die vom Sturz des Ölpreises arg gebeutelte Wirtschaft eine stabilisierende Aufbauspritze benötigt.
Lourenço überraschte durch einen unerwartet unnachgiebigen Feldzug gegen die grassierende Korruption auf höchster Ebene. Selbst die vier Kinder von Dos Santos, die sich dank der Protektion ihres Vaters an die Schalthebel der Wirtschaft in den staatseigenen Betrieben manövriert hatten, blieben nicht verschont. Isabel dos Santos, die als reichste Frau Afrikas gilt, wurde gar das Imperium des staatlichen Ölkonzerns Sonangol abgenommen. Auch zahlreiche Minister und andere höhere Amtsträger mussten Federn lassen.
Lourenço kündigte außerdem eine Gnadenfrist für den Rücktransfer der in Steueroasen versteckten Gelder an, die auf 30 Milliarden Dollar geschätzt werden. Danach sollen die Veruntreuungen und Steuerhinterziehungen juristisch geahndet werden. Damit setzte er zumindest symbolisch ein deutliches Zeichen. Allerdings bleibt abzuwarten, wie ernst es dem neuen Besen wirklich damit ist, den Stallmist auszukehren – beziehungsweise welchen Handlungsspielraum ihm die etablierte Machtelite dafür zubilligt.
Ende eines Despoten
Dem geordneten Stabwechsel in Angola folgte Mitte November 2017 überraschend der sanfte Coup durch das Militär in Simbabwe (siehe mein Beitrag in E+Z/D+C e-Paper 2018/1, S. 13). Seit der Unabhängigkeit 1980 hatte das einstige Juwel Afrikas unter der Fuchtel Robert Mugabes gestanden, der auch mit 93 Jahren keinesfalls an den Ruhestand dachte. Noch kurz zuvor hatte ihn die ZANU-PF (Zimbabwe African National Union-Patriotic Front) zum Kandidaten für die nächsten Präsidentschaftswahlen nominiert. Erst als er seine Frau Grace als Nachfolgerin installieren wollte und daranging, ihre Konkurrenten aus dem Weg zu räumen, überreizte er die Karten.
Dass Mugabe seinen Stellvertreter und jahrzehntelangen treuen Gefolgsmann Emmerson Mnangagwa schasste, war ein Fehler, der ihn das Amt kostete. Das Militär griff ein, der Despot musste das Feld räumen, und heute sitzt Mnangagwa selbst im Chefsessel. Teile der Bevölkerung bejubelten ihn in der ersten Euphorie über den so lange erhofften Abgang Mugabes als Erlöser. Doch von Beginn an gab es die Befürchtung, der Teufel sei mit dem Beelzebub ausgetrieben worden.
In der Tat mehren sich die Zeichen, dass Mnangagwa keine Alternative zum autoritären und repressiven Charakter des politischen Systems darstellt. Dass er am Machtwechsel beteiligte hochrangige Militärs in die Regierung berief, konnte kaum als vertrauensbildende Maßnahme missverstanden werden. Doch bestehen Hoffnungen, dass er den wirtschaftlich seit Jahrzehnten in den Dreck gefahrenen Karren wieder halbwegs flott kriegt. Um das Vertrauen ausländischer Investoren wiederherzustellen, kündigte der Staatschef sogar an, dass die im Zuge der Landreform um die Jahrtausendwende enteigneten Farmer eine Entschädigung bekommen. Doch auch hier gilt, wie im Falle der erhofften Reformen in Angola: Sehen ist Glauben.
Palastrevolution
Hart zur Sache ging es in Südafrika. Zwei Exponenten unterschiedlicher Fraktionen konkurrierten um die Nachfolge des angeschlagenen Präsidenten Jacob Zuma an der Spitze des African National Congress (ANC): sein Vize Cyril Ramaphosa und seine Ex-Frau Nkosazana Dlamini-Zuma. Diese galt weithin als Zumas Rückversicherung, um seine missbräuchliche Amtsführung möglichst unversehrt zu überstehen. Ramaphosa hingegen wurde von vielen – insbesondere außerhalb des ANC – als Hoffnungsträger für ein Ende der Misswirtschaft gesehen.
Allerdings trug der stellvertretende Staatschef zumindest indirekt Mitverantwortung am Massaker von Marikana 2012, bei dem Polizisten Dutzende streikende Minenarbeiter ermordeten. Doch im Vergleich zu einer Nachfolgerin aus Zumas Umfeld lag die Präferenz beim früheren Gewerkschafter und erfolgreichen Geschäftsmann Ramaphosa. Das Wahlergebnis fiel dennoch nur knapp zu seinen Gunsten aus und dokumentierte so den Einfluss, den Zuma und seine Vasallen und Günstlinge noch hatten. In insgesamt sechs ANC-Führungspositionen wurde Ramaphosa mit drei Zuma-Loyalisten vermeintlich Läuse in den Pelz gesetzt.
Allerdings zeigte sich schnell, dass ein gerüttelt Maß an Opportunismus der Tendenz Vorschub leistete, am Thron des Staatspräsidenten zu sägen, um die eigene Haut zu retten. Mit Zunahme der Informationen hinsichtlich des Ausmaßes an Machtmissbrauch unter Zuma und Konsorten riss der Mehrheit der Mitglieder der Parteigremien der Geduldsfaden. Anfang Februar spitzte sich die Lage zu, und die Forderungen nach Zumas Rücktritt mehrten sich, um seinem Nachfolger in der Partei auch den Weg ins höchste Staatsamt freizumachen. Nach einem ähnlichen Tauziehen wie einige Monate zuvor in Simbabwe warf Zuma am 14. Februar das Handtuch, um einem Misstrauensvotum im Parlament zuvorzukommen.
Die Palastrevolution war vollzogen. Ihr Verlauf machte hingegen deutlich, dass Südafrika im Unterschied zu Simbabwe auch weiterhin ein Rechtsstaat ist, in dem die Politik innerhalb vorgegebener Richtlinien operiert. Die erhoffte Rekonvaleszenz des durch langjähriges Parasitentum geschwächten Patienten wird allerdings noch einige Zeit und Kraft erfordern. Auch bleibt abzuwarten, ob der Machtwechsel noch rechtzeitig genug erfolgte, um dem ANC auch in den nächsten Parlamentswahlen Mitte 2019 eine absolute Mehrheit zu sichern.
Gewaltpotenzial und Korruptionsskandale
Auch in Sambia steht trotz einer deutlich jüngeren Politikergenration nicht alles zum Guten: Ein ohnehin eher fragiles System wechselnder Regierungen sorgt unter den autoritär-repressiven Tendenzen von Präsident Edward Lungu von der Patriotic Front für wachsende Unruhe. Dass sein Rivale Hakainde Hichilema von der UNDP (United Party for National Development) aus ähnlichem Holz geschnitzt ist, schürt das Gewaltpotenzial an.
Mosambik ist derweil von Korruptionsskandalen und zunehmenden Wirtschaftsproblemen geprägt. Der einstige Liebling der Gebergemeinschaft hat schon längst das Vertrauen verspielt. Mit der Entdeckung „versteckter Schulden“ von zwei Milliarden Dollar hat die Regierung jegliches Ansehen sowie erhebliche Entwicklungsgelder verloren.
Auf der Suche nach dem Positiven fällt der Blick auf die frühere deutsche Kolonie Namibia. Dort gibt es zwar ebenfalls Probleme: Das Land schlitterte 2016 in seine bislang dramatischste Wirtschaftskrise und steckt seither in einer Rezession, die fast zum Staatsbankrott geführt hätte. Viele vollmundig angekündigte Reformpläne blieben unverwirklicht, und in Namibia herrschen weiterhin große Einkommensunterschiede. Doch im Gegensatz zu den Nachbarländern, in denen ebenfalls ehemalige Befreiungsbewegungen an der Macht sind, verstand es die SWAPO (South West African People’s Organisation), seit der Unabhängigkeit 1990 ihre Vormachtstellung zu konsolidieren (siehe mein Beitrag in E+Z/D+C e-Paper 17/02, S. 18). Namibia kann auf eine beachtliche Stabilität ohne politisch motivierte Gewalt verweisen. Geordnete Wahlen und geregelte Amtszeiten von mittlerweile drei Präsidenten tragen zum positiven Image bei.
Doch auch in den Reihen der SWAPO brodelt es, denn das seit März 2015 amtierende, mit 86 Prozent der Stimmen direkt gewählte Staatsoberhaupt Hage Geingob ist nicht unumstritten. Der Parteikongress im November 2017, bei dem mehr als 600 Delegierte die Parteiführung neu wählten, wurde im Vorfeld von erbitterten Rivalitäten konkurrierender Fraktionen überschattet. „Team Hage“ überstand die Attacken ohne Blessuren und sicherte sich ein unerwartet eindeutiges Mandat: In alle Führungspositionen der Partei wurden Geingob und seine Gefolgschaft gewählt, und auch die Zusammensetzung des Zentralkomitees und Politbüros der Partei ist ohne nennenswerte Abweichung.
Es mehren sich die Zeichen, dass dies zu einer parteiinternen „Flurbereinigung“ führt, in der die Opponenten die Zeche für ihr unbotmäßiges Benehmen zahlen. Auf der Strecke bleiben könnte dabei das Demokratieverständnis. Präsident Geingobs Wiederwahl 2019 jedenfalls scheint gesichert. 2025 würde er dann als „Elder Statesman“ in den Ruhestand wechseln, falls ihn vorher nicht das Schicksal eines Mugabe oder Zuma ereilt. Denn trotz seiner unangefochtenen Führungsrolle nimmt die Unzufriedenheit in der Bevölkerung zu. So muss er die Mammutaufgabe bewältigen, den seit seinem Amtsantritt schwindelerregenden wirtschaftlichen Niedergang rückgängig zu machen und der Bevölkerungsmehrheit ein besseres Leben zu ermöglichen. Dieses Versprechen nicht einzulösen würde ihm selbst und dem Image des Landes schaden.
Staatskleptokratie
Um Südafrika wieder in innenpolitisch ruhigere Gewässer zu steuern, muss sich Präsident Ramaphosa – der einst Nelson Mandelas bevorzugter Nachfolger war – einer ähnlichen Aufgabe widmen, wie sie die anderen „Neulinge“ und Geingob zu bewältigen haben. Eine halbwegs geregelte Regierungsverantwortung, die der organisierten Plünderung von Ressourcen unter staatlicher Kontrolle ein Ende setzt, ist die Voraussetzung für die dringliche Erholung der Wirtschaft und bessere Regierungsführung.
Mit der Entmachtung Zumas alleine ist das nicht getan. Er personifizierte ein System, das die gesamte Struktur des Staats und seiner Betriebe zur persönlichen Bereicherung unter Kontrolle brachte. Auch in Südafrika gilt wie in Angola und Simbabwe trotz aller Unterschiede, dass sich die Staatskleptokratie in einem Ausmaß verfestigte, dass es mit dem bloßen Wechsel des Staatsoberhauptes längst nicht getan ist. Eine wirtschaftliche Erholung käme dabei nicht nur dem Lande – und hoffentlich der Mehrheit in der Bevölkerung – zugute, sondern der gesamten Region. Schließlich gilt noch immer: Wenn Südafrika hustet, haben die Anrainerstaaten die Grippe. Doch auch wenn es unter Ramaphosa zu der erwarteten relativen Stabilisierung kommen sollte, wäre damit die allgemeine Flurbereinigung in der Region keinesfalls vorüber.
Es besteht weiterhin die Frage, was demnächst in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) passiert. Sollte es dort nicht bald zu einem halbwegs friedlichen Machtwechsel kommen, wären die Konsequenzen nicht nur für die dort lebenden Menschen fatal. Nicht zuletzt Südafrika hätte mit einer weiter steigenden Zahl von Flüchtlingen zu rechnen. Auch die Gastfreundschaft anderer Nachbarstaaten würde wohl auf eine harte Probe gestellt.
Joseph Kabila übernahm zehn Tage nach der Ermordung seines Vaters im Januar 2001 in der DRK die Macht. 2006 und 2011 wurde er durch eher zweifelhafte Wahlen im Amt bestätigt. Sein Versprechen, spätestens Ende 2017 die Macht abzugeben, hat er gebrochen; nun soll zur Jahresmitte 2018 ein Nachfolger gewählt werden. Doch der relative Friede ist schon lange gestört, und immer wieder führten politisch motivierte Proteste zu zahlreichen Toten. Zugleich eskalierte erneut ethnisch motivierte Gewalt im Nordosten des Landes so sehr, dass wieder einmal Tausende von Flüchtlingen Schutz im benachbarten Uganda suchen. So hat die 16 Länder umfassende Southern African Development Community (SADC), die weithin als die friedlichste Region auf dem Kontinent gelobt wird, derzeit viel zu tun.
Henning Melber ist Senior Research Associate am Nordic Africa Institute und Extraordinary Professor der Universitäten in Pretoria und Bloemfontein.
henning.melber@nai.uu.se