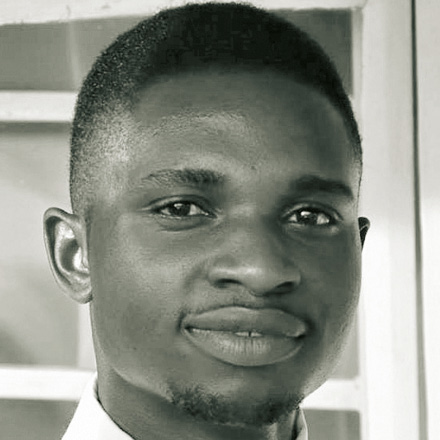Katastrophenvorsorge
Einstellungswandel

Naturkatastrophen gehören zum Leben auf den 7000 philippinischen Inseln. Bis zu ihrem 21. Geburtstag erleben Filipinos im Schnitt mehr als 200 tropische Stürme mit Windgeschwindigkeiten über 118 Stundenkilometern, deren typische Folgen Hochwasser und Erdrutsche sind. Auch Erdbeben und Vulkanausbrüche sind nicht ungewöhnlich.
2017 standen die Philippinen mit einer Bevölkerung von 100 Millionen an dritter Stelle im Ranking des Weltrisikoindexes, den das Bündnis Entwicklung Hilft berechnet. Der Index bewertet 173 Länder sowohl hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit von Naturkatastrophen als auch ihrer Fähigkeit, die Folgen zu bewältigen. Auf den ersten beiden Plätzen lagen die kleinen Inselnationen Tuvalu und Tonga.
„Ob ein Naturereignis zur Katastrophe wird, hängt nicht nur von seiner Intensität ab, sondern auch vom Entwicklungsstand der jeweiligen Gesellschaft“, sagt Isagani Serrano, der Vorsitzende des regierungsunabhängigen Rural Reconstruction Movement und einer der Spitzenvertreter von Social Watch Philippines.
Pedro Walpole vom Ateneo de Manila, einer angesehenen katholischen Universität, sieht das auch so. Ein Taifun sei nur dann eine Katastrophe, wenn er Menschenleben fordere. Das werde aber laut Urteil des geistlichen Wissenschaftlers immer wieder geschehen, denn auf den Philippinen „leben schrecklich viele sehr arme, ausgegrenzte Menschen, die nicht wissen, wo sie hin sollen“.
Belege dafür bieten Statistiken von Social Watch:
- Mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt an der Küste und ist folglich Taifunen und Sturmfluten ausgesetzt.
- Etwas mehr als ein Viertel ist so arm, dass es Schäden nicht reparieren und materielle Verluste nicht wieder aufholen kann.
- Ein Fünftel ist mangelernährt, so dass ihr Immunsystem Gesundheitsrisiken nach Stürmen wenig entgegenstellen kann.
Die traditionelle Haltung der Filipinos zu Katastrophen lässt sich am besten mit dem Spruch „bahala na“ zusammenfassen. Er bedeutet: „Lasst uns Gott vertrauen.“ Ausländer halten es für Fatalismus, wie Filipinos Naturgewalten resigniert zu akzeptieren scheinen. Der prominente, 2005 verstorbene Psychologe Alfredo Lagmay interpretierte „bahala na“ jedoch anders. Ihm zufolge ging es darum, Risiken einzugehen und die Möglichkeit des Scheiterns zu ertragen. Es helfe Menschen, harte Zeiten zu bestehen, und gleiche einem „Tanz mit dem Kosmos“.
Nach der Unabhängigkeit im Jahr 1946 reagierten die Regierungen der Philippinen jahrzehntelang fatalistisch und opportunistisch auf Desaster – gleichsam ein Ritual des „Morgens nach dem Sturm“. Grundgedanke war, dass nichts getan werden konnte, um Katastrophen zu verhindern, so dass Politiker nur danach so schnell wie möglich Hilfe mobilisieren sollten. Betroffene Familien wurden in Schulen untergebracht, bis die Fluten wieder abgeflossen waren. Reissäcke und Dosennahrung trugen den Namen des Politikers, der sie verteilte. Nothilfe diente also Wahlkampfzwecken. Heute ist derlei allerdings verpönt.
Abgesehen von Notversorgung, hatten die Kommunalverwaltungen nichts zu tun. Die Armee war dafür zuständig, Vermisste zu suchen und zu retten. Sie räumte Straßen frei und reparierte sie.
Ungenügendes Management nach Katastrophen beendete manche politische Karriere. Der Ballungsraum Manila wurde im September 2009 wegen des Taifuns Ketsana überschwemmt. Die damalige Präsidentin Gloria Macapagal-Arroyo hielt ihrem Verteidigungsminister Gilbert Teodoro für einen geeigneten Nachfolgekandidaten im Wahlkampf 2010. Es gelang ihm aber nicht, mit Schlauchbooten von den Fluten gefangene Hauseigener zu befreien, und das trug dazu bei, dass seine Kandidatur fehlschlug. Der Taifun änderte allerdings die Haltung der Regierung.
Neue Konzepte
2010 beschloss der von Arroyo dominierte Congress wegweisende Reformen. Er richtete den National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) ein. Sowohl das Management von Desaster-Risiken (disaster risk management – DRM) und ihre Reduzierung (disaster risk reduction – DRR) waren neue Konzepte. Die Gesetzgebung erfüllte das Versprechen der Philippinen, den Hyogo Framework for Action umzusetzen, den eine UN-Konferenz über Resilienzbildung 2005 in Japan beschlossen hatte.
Carmelita Laverinto von der Zivilverteidigungsbehörde bewertet das heute als Paradigmenwechsel. Zuvor hätten staatliche Stellen und Nothilfeorganisationen Katastrophen als Einzelereignisse gesehen und entsprechend gehandelt. Weder die sozialen und wirtschaftlichen Folgen von Katastrophen noch ihre Ursachen seien ernsthaft durchdacht worden. Seit der Gesetzesänderungen sind alle staatlichen Ebenen von der nationalen bis zu kommunalen zu DRM und DRR verpflichtet.
DRM hält die Behörden das ganze Jahr lang auf Trab. Der NDRRMC definiert Ziele und Konzepte für die Katastrophenvorsorge. Städte, Gemeinden und Provinzen (local government units – LGUs) müssen beispielsweise Risikolandkarten erstellen, in denen Gegenden markiert sind, wo Erdrutsche, Sturmfluten, Hochwasser oder andere Schadensursachen wahrscheinlich sind. Früher wurden solche Karten, wenn es sie denn überhaupt gab, geheim gehalten, denn Immobilienspekulanten nutzen Kontakte zu Politikern, um beispielsweise Häuser in trockenen Flussbetten zu bauen. Bei DRR geht es darum, die Verwundbarkeit der Bevölkerung zu reduzieren und ihre Fähigkeit, Unbillen zu widerstehen, zu stärken.
Bei einer Überprüfung stellte Laverinto 2014 fest,
- dass noch keine Kommune mit dem nationalen Siegel der Katastrophenvorsorge ausgezeichnet worden war,
- wobei der Hauptgrund das Missverhältnis zwischen den Zuständigkeiten der LGUs und ihren Kapazitäten war.
Den LGUs fehlte beispielsweise Fachpersonal für DRR und DRM. Sie hatten auch keine Mittel für Frühwarnsysteme, die Suche nach Vermissten, Evakuierungen, Krankenversorgung et cetera. Die Lage hat sich seither etwa verbessert, und mittlerweile haben mehrere Dutzend Kommunen das Siegel. Dazu hat sicherlich Taifun Haiyan beitragen.
Der Supersturm
Im November 2013 zeigt Taifun Haiyan auf brutale Weise, wie wenig lokale Gemeinschaften der Naturgewalt entgegenstellen konnten. Der Supersturm verwüstete die Stadt Tacloban (auf Leyte) und wütete auch auf anderen zentralphilippinischen Visayas-Inseln. Internationale Hilfswerke waren schnell zur Stelle. Sie wurden dringend gebraucht und waren willkommen. Schattenseiten waren indessen nicht zu übersehen (siehe Kasten).
Lourdes Padilla-Espenido war als Vertreterin der unabhängigen Frauen- und Jungendrechtsorganisation WeDpro im Katastrophengebiet. Ihr zufolge waren die LGUs traumatisiert. Weil ihr Personal und ihre Leitung selbst Angehörige und Heime verloren hatten, reagierten sie nur langsam auf die Ereignisse.
Aus Espenidos Sicht gab es aber mindestens zwei Lichtblicke, was Vorbeugung anging:
- In der Gemeinde Palo waren fast alle Häuser zerstört, aber einige standen noch. Es stellte sich heraus, dass diese den Bauvorschriften entsprechend errichtet worden waren.
- An einem Küstenstreifen in der Provinz Capiz hatte die Sturmflut ein Dorf weniger stark überschwemmt als Tacloban. Anwohner sagten Espenido, die Mangroven hätten sie gerettet. Mit internationaler Geberunterstützung hatten sie den Uferwald aufgeforstet.
Zu den schlechten Erfahrungen gehörte dagegen, dass der damalige Bürgermeister von Tacloban, Alfred Romualdez, ein Angehöriger der Sippe des früheren Diktators Ferdinand Marcos, die Anwohner nicht ausreichend warnte. Er wusste nämlich nicht genau, was „Sturmflut“ bedeutet. Mar Roxas, die Ministerin für LGU-Angelegenheiten, vergaß derweil, ein Satellitentelefon mit ins Katastrophengebiet zu nehmen. Präsident Benigno Aquino III wirkte emotionslos, distanziert und gleichgültig. Er sagte später, er habe sich beherrscht, um seinen Aufgaben gerecht zu werden – aber die Bevölkerung von Leyte fühlte sich im Stich gelassen.
Zu den Leuten, die mit ihren Hilfslieferungen in Tacloban herzlich empfangen wurden, gehörte im November 2013 Rodrigo Duterte – damals noch Bürgermeister der Stadt Davao auf Mindanao. Als der Sturm wütete, müsse „Gott anderswo gewesen“ sein, sagte er Journalisten und war den Tränen nahe.
Heute gehörte es zu Dutertes Pflichten als Präsident, die Nation vor Katastrophen zu schützen. Auf seiner Tagesordnung sollten DRR und DRM hoch oben stehen. Es ermutigt aber nicht, dass er die Mittel des Calamity Fund, welcher der Nothilfe dient, gekürzt hat. Für das Haushaltsjahr 2016 hatte die Aquino-Regierung umgerechnet rund 780 Millionen Dollar vorgesehen. Dutertes erster Haushalt reduzierte die Mittel für 2017 um etwa 60 Prozent. Für das laufende Jahr stieg die Finanzierung wieder leicht um 385 Millionen Dollar. Davon sind aber 196 Millionen für den Wiederaufbau der in schweren Kämpfen von Islamisten befreiten Stadt Marawi auf Mindanao vorgesehen, und weitere 39 Millionen sollen der Rehabilitation der berühmten Touristeninsel Boacay dienen. Für eine unerwartete Katastrophe stehen nur noch 150 Millionen bereit. Solch ein Summe kann ein einziger Taifun aufzehren.
Isagani Serrano vom Social-Watch-Führungsteam findet die Kürzungen überraschend. Angesichts der hohen Katastrophenrisiken auf den Philippinen müsse Vorbeugung hohe Priorität haben. Positiv ist aber wohl, dass Duterte zwar über die UN schimpft, weil sie seinen äußert gewalttätigen Krieg gegen die Drogen kritisieren (siehe E+Z/D+C e-Paper, 2017/10, S. 15), dass das NDRRMC und die Zivilverteidigungsbehörde aber dennoch eng mit UN-Institutionen bei Risikoreduzierung und -management kooperieren.
Raissa Robles ist investigative Journalistin und Verlegerin. Sie lebt in Manila.
twitter.com/raissawriter
https://raissarobles.com