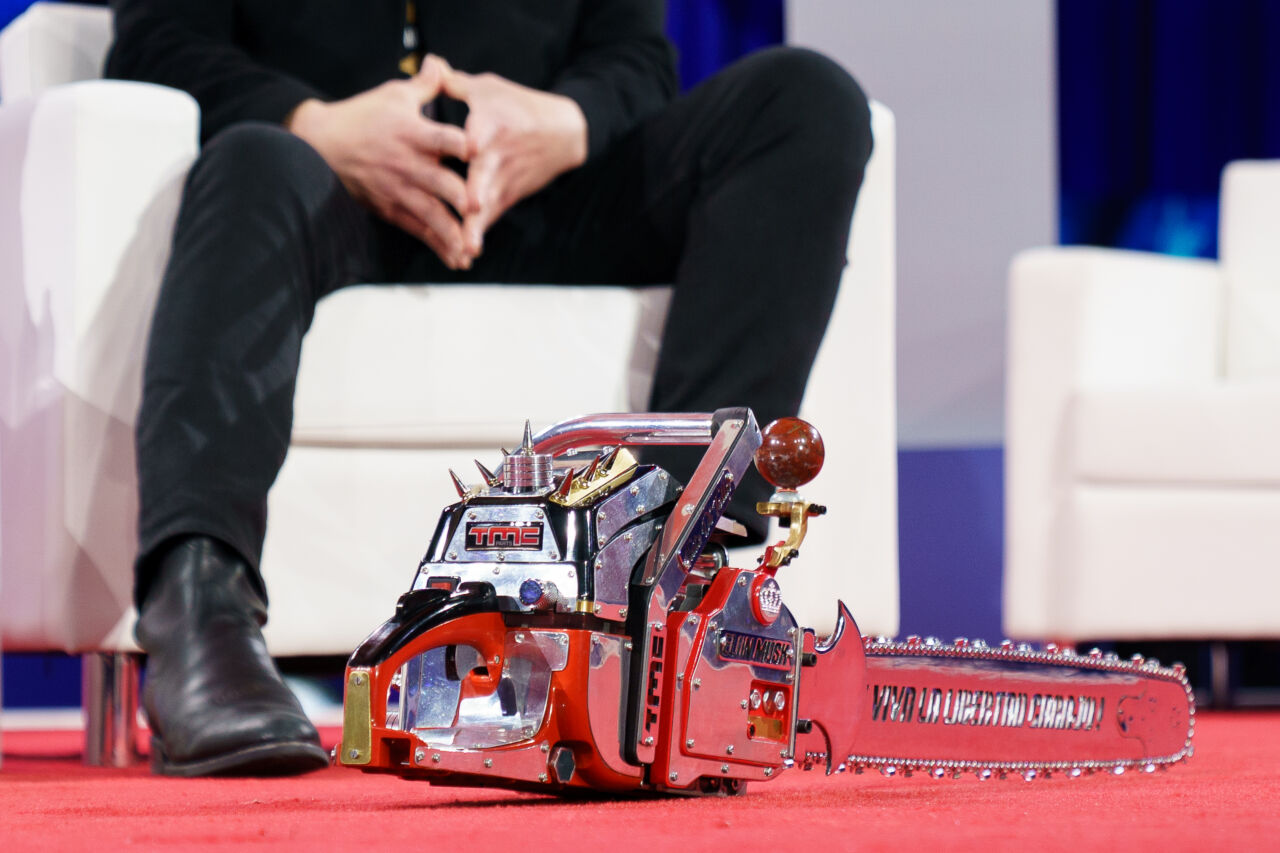Frauenrechte
Männer in Frauenrechtsaktivismus einbeziehen

Was denken Sie über feministische Entwicklungspolitik?
Es ist ein gut formulierter Begriff, den es aber sinnvoll mit Inhalten zu füllen gilt. Ich arbeite seit Jahren mit entwicklungspolitischen Programmen, und die Strategie des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) hört sich für mich nicht wirklich neu an. Das BMZ sagt, es will feministische Anliegen in alle Programme integrieren und die patriarchalen Machtstrukturen verändern. Danach streben wir schon seit Jahren. Das gilt auch für das BMZ, und wenn es diese Anliegen noch stärker betont, ist das gut. Wenn man das Leben der Frauen zum Besseren verändern will, ist es aber nicht sinnvoll, sich nur an Frauen zu richten. Männer mit einbeziehen ist wichtig. Die gesamte relevante Familie muss mitmachen.
Warum?
Die Vorstellung, dass die Frau allein über sich und ihren Körper bestimmt, mag für den europäischen Kulturkreis zutreffen. In afrikanischen oder arabischen Gesellschaften ist dies aber ganz anders. Da bestimmen der Mann, die Schwiegermutter oder die Tanten mit, wann eine Frau Kinder bekommt und wie viele. Die kulturellen Gegebenheiten sind einfach ganz anders, als sie Europäer kennen. Frauen fällen viele Entscheidungen nicht individuell, sondern im Kollektiv. Wenn ich also etwas erreichen will, wie in meinem Fall die Beendigung von weiblicher Genitalverstümmelung, auch Female Genital Mutilation – FGM genannt, muss ich alle relevanten Akteur*innen davon überzeugen, dass das auch gut für sie ist.
Wie überzeugen Sie Männer und die Gemeinschaften davon, dass FGM nicht gut für sie ist?
Ich brauche jedenfalls nicht mit Menschenrechten zu argumentieren, denn das Konzept verstehen gerade arme Frauen, die kaum zur Schule gegangen sind, nicht. Das Ritual der Beschneidung steckt so tief in der Kultur mancher Volksgruppen, und sie definieren sich darüber. Es ist eine Verbindung zu ihren Ahnen, und das ist in vielen afrikanischen Gesellschaften sehr wichtig. Der Ursprung von FGM ist nicht religiöser oder kultureller Natur, sondern spiritueller. Das Ritual kommt laut Studien aus dem alten Ägypten, wo nur Beschnittene – und das galt gleichermaßen für Frauen wie für Männer – in den Tempel durften. Viele Völker Afrikas, so auch meine Volksgruppe der Fulani, stammen von den Ägyptern ab und wanderten dann über den Kontinent. Die Tradition der Beschneidung hat sich über die Jahrtausende erhalten und wird deshalb von Christentum und Islam praktiziert. Ich muss so argumentieren, dass die Frauen selbst zu dem Schluss kommen, dass sie diese Allianz mit ihren Vorfahren nicht mehr brauchen. Bei meiner Familie hat es funktioniert. Meine Brüder haben irgendwann gesagt, wir wollen das nicht mehr, und so wurde seit 1995 kein Mädchen mehr in meiner Familie beschnitten.
Wie sind Sie zu der Erkenntnis gekommen, dass auch Männer in feministische Politik einbezogen werden müssen?
Ich habe das nie anders gesehen. Das liegt in meiner Natur, so verstehe ich den Umgang der Geschlechter miteinander. Es ist ein gemeinschaftliches Miteinander. Ich glaube, das ist ein Unterschied zwischen afrikanischer und europäischer Mentalität. In Europa sind Männer und Frauen Gegensätze, oft führen sie Krieg. In Afrika legt man viel mehr Wert auf Harmonie, jeder hat seine Rolle in der Gesellschaft, und das wird viel weniger in Frage gestellt als in Europa. Diese Gegebenheiten muss man in den Programmen berücksichtigen. Geschieht dies nicht, kann es leicht zum Scheitern führen.
Haben Sie dafür Beispiele?
Ja, ich kenne ein Programm in Ghana, da hat man Frauen ein Stück Land gegeben, auf dem sie Mais oder Tomaten anbauen konnten. Die Verantwortlichen hatten aber nicht daran gedacht, dass Männer den Transport der Feldfrüchte zu den Märkten organisieren, und so hatten die Frauen große Schwierigkeiten, ihre Ernte abzutransportieren, und mussten enorme Verluste hinnehmen.
Wie beziehen Sie Männer in Ihre Arbeit für Frauen konkret mit ein?
Ich habe mit meinem Verein Forward for Women das Projekt „Saraba“ ins Leben gerufen, das sich an die afrikanische Diaspora-Community in Frankfurt richtet und auch an Geflüchtete in der ASB-Flüchtlingsunterkunft in Frankfurt-Nied, in der ich arbeite. Es ist ein Programm zur Gewaltprävention. Migrant*innen und Geflüchtete kommen oft aus patriarchalischen Gesellschaften, wo sie vielfach häusliche und auch staatliche Gewalt erlebt haben. Um die Betroffenen zu stärken und zu ermutigen, führt Forward for Women Schulungen und Diskussionsrunden in der Community und auch in Flüchtlingseinrichtungen durch. Dabei arbeiten wir nicht nur mit Frauen, sondern beziehen auch Männer ein, und wir betrachten sie nicht als potenzielle Täter, sondern als Verbündete und als Teil der Lösung.
Aber Männer sind doch in der Regel die Täter ...
Ja, das stimmt. Aber ich denke, dass nur gemeinsam mit allen Geschlechtern ein Umdenken zu gewaltfreiem Handeln in der Gesellschaft zu erreichen ist. Männer sollen verstehen, warum ein gewaltfreier Umgang mit Frauen und Kindern ihnen und der ganzen Gesellschaft nutzt. Unser Ziel ist es, dass sich die Betroffenen durch gemeinsames Reflektieren neue Kompetenzen und Lösungsansätze im Umgang mit Konflikten aneignen. Diese Art der Gewaltprävention sehe ich übrigens auch als eine wichtige Voraussetzung, um sich der deutschen Gesellschaft gegenüber zu öffnen. Wir machen ein Angebot speziell für Männer in den Flüchtlingsunterkünften. Diese fühlen sich oft ausgeschlossen. Es gibt kaum Sprachkurse für sie oder andere Gruppenaktivitäten, wie gemeinsames Kaffeetrinken, wo sie zum Beispiel auch mal in Kontakt mit Deutschen kommen.
Es fehlt also an spezifischen Angeboten für Männer?
Ich finde ja. Das Problem ist, dass für Frauenprojekte Geld zur Verfügung steht. Projekte, die sich an Männer richten, will niemand finanzieren. Das gilt besonders für junge Flüchtlinge. Deshalb haben wir 2018 in der Unterkunft in Nied eine Männergruppe gegründet, die sich einmal im Monat trifft und über Geschlechterrollen, Frauenrechte oder Kindererziehung diskutiert. Daraus ist eine Fußballmannschaft entstanden, die sehr aktiv ist und beim Training und Spielen auch deutsche Teams trifft. Nach dem Sport regen wir dann alle Männer an, sich zu Diskussionsrunden zu treffen, um über Identitätsfindung, Geschlechterrollen, Demokratieverständnis und ähnliche Themen zu sprechen. Solche Angebote sind wichtig für die Integration in Deutschland, denn so lernen die Geflüchteten die Regeln und Kultur der Aufnahmegesellschaft kennen. Auch andersherum wäre es gut, wenn Deutsche mehr Gelegenheit hätten, Geflüchtete kennen- und verstehen zu lernen.
Mariame Racine Sow arbeitet als Sozialberaterin in einer Flüchtlingsunterkunft des Arbeiter-Samariter-Bunds in Frankfurt und engagiert sich in ihrem Verein Forward for Women ehrenamtlich.
mariame.sow@forwardforwomen.org
https://forwardforwomen.org/