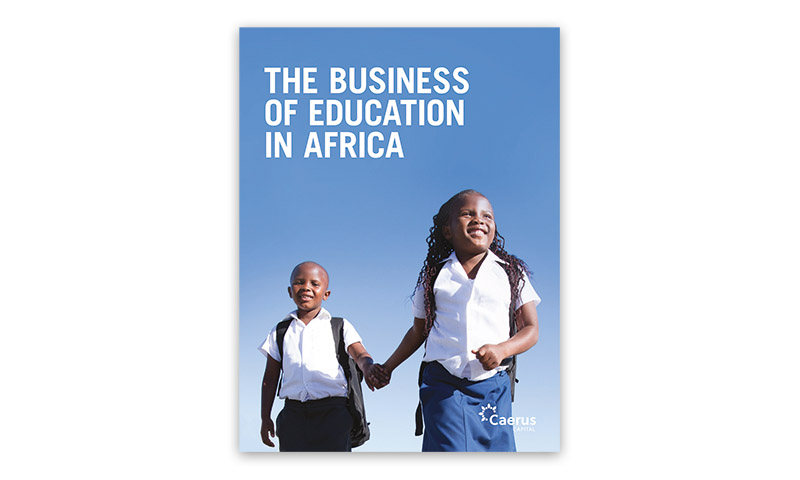Landwirtschaft
Feuer-Bauern

Ein aus Baumstämmen gebauter Torbogen markiert, inmitten gelb-grauer Steppe, den Eingang zum Anwesen von Lesa, der Führerin der Lamba-Volksgruppe. Außerhalb Mpongwes, eines Städtchens im Norden Sambias, leben Lesas Mitarbeiter in grasbedeckten Hütten. Ihr selbst dient ein Häuschen aus roten Ziegeln als Residenz. Daneben steht ein nach allen Seiten offener Versammlungspavillon, dessen Dach auf Baumstämmen ruht. Würdevoll schreitet die noch junge Stammesführerin zu einem hölzernen Lehnstuhl; die Besucher knien nieder, überreichen einen Sack Maismehl und einen Kanister Speiseöl. Dann kommt Lesa mit energischer Stimme zur Sache.
Die Bauern ihres Volkes bräuchten viel Land, um ihre Familien zu ernähren, sagt die Stammesführerin. Auf jeweils ein, zwei Hektar baut ein Bauer Mais und Maniok an. Aber nach drei oder vier Jahren ist das Land erschöpft und muss 30 Jahre brach liegen. „Es ist meine Pflicht, den Bauern neues Land zuzuteilen – eine Pflicht, der ich kaum mehr nachkommen kann." Ihr Volk wachse immer schneller. „Doch die Regierung hat uns schon vor Jahrzehnten viel Land weggenommen und es kommerziellen Farmern gegeben."
Auch das Dorf Ruace im Norden Mosambiks, nahe der Stadt Gurúe, liegt in karger Steppe: eine schier endlose Fläche geduckter Beton- und Wellblechhütten, umgeben von kümmerlichen Maisfeldern. Die Existenzgrundlage der Menschen sei die Landwirtschaft, sagt Paulo Imede, Leiter einer Bauernorganisation. Und um die sei es nicht gut bestellt. „Die Böden hier in den Bergen der Provinz Niassa sind steinig und halten kaum Wasser." Man muss tief graben, um überhaupt etwas anpflanzen zu können. Das aber geht nicht ohne Maschinen. „Weil wir die nicht haben, leben wir hier in bitterer Armut", klagt Imede.
Sambia und Mosambik sind dünn besiedelte Länder. Auf je der doppelten Fläche Deutschlands leben in Sambia 14 Millionen Menschen, in Mosambik 24 Millionen. Beide Länder erleben seit Jahren einen Wirtschaftsboom, der jedoch ausschließlich vom Export herrührt: Kupfer in Sambia, Aluminium und Kohle in Mosambik. Dieser Boom schafft kaum Arbeitsplätze, da die Rohstoffe nicht im eigenen Land weiterverarbeitet werden. Im Schatten neuer Glaspaläste in den Hauptstädten Lusaka und Maputo wuchern darum auch weiterhin die Slums, deren Bewohner sich von Kleinhandel und Schuhputzen ernähren. Fast die Hälfte der Menschen in beiden Ländern ist unterernährt. Am schlimmsten ist die Armut auf dem Land, wo bis heute der Großteil der Bevölkerung lebt – und das, obwohl es reichlich Ackerland gibt.
Unfruchtbare Böden
Warum die Menschen so arm sind, erklärt Agrarexperte George Allison. Er arbeitet auf einer Weizen- und Sojafarm nördlich von Mumbwa. Die Fahrt dorthin führt vorbei an Lagerhallen und eingezäunten Weizenfeldern großer Farmen; dann durch mit hohen Laubbäumen bewachsene Waldsavanne. Immer wieder tauchen entlang der Straße abgeholzte und abgebrannte Flächen auf.
Die Ackerböden Sambias und Mosambiks seien von Natur aus sauer und nährstoffarm, sagt George Allison. Fast überall im südlichen Afrika seien, außer in den Flusstälern, die Böden ziemlich unfruchtbar. Diese uralten, verwitterten Böden enthielten kaum organische Nährstoffe; fast alles habe heftiger Regen im Laufe von Jahrmillionen ausgewaschen. Aber auch solche Böden können hohe Erträge liefern, meint Allison – mit Kalk, hochwertigem Saatgut und richtig dosierter Düngung.
Tatsächlich ernten die wenigen großen Farmer Sambias im feuchten Sommer drei Tonnen Soja pro Hektar und im trockenen Winter, künstlich bewässert, zehn Tonnen Weizen. Und das Verblüffende: Ihr Land ist auch nicht besser als das der Kleinbauern, die mit mühsamer Arbeit gerade 500 Kilo Mais pro Hektar ernten – in Sambia wie in Mosambik.
Diese Kleinbauern betreiben bis heute so genannte Landwechselwirtschaft: Sie roden ein, zwei Hektar und bearbeiten sie zwei bis drei Jahre mit Feuer, Hacke und Pflug – was den Böden rasch die letzten Nährstoffe entzieht. Sie säen ertragsarme Mais- und Manioksorten, düngen gar nicht oder falsch. Sie bewässern nicht und tun kaum etwas gegen Schädlinge und Unkraut: eine Landwirtschaft mit eingebauter Armutsgarantie, die auch der Umwelt nicht guttut und den Klimawandel anheizt.
Rauchglocke über dem südlichen Afrika
Monatelang liegt im südafrikanischen Winter eine Rauchglocke über dem Subkontinent. Und wer zu dieser Zeit die vielerorts brennende Savanne durchquert, sieht am Himmel nur Grau, bis am Spätnachmittag ein wenig die Sonne sichtbar wird – als verschleierter glutroter Ball.
Überall entlang der Straßen Sambias sieht man schwarze Flächen. Dies komme von der Chitemene, der sambischen Form des Brandrodungsfeldbaus, erklärt George Allison: „Der Bauer fällt auf einem kreisförmigen Stück Land alle Bäume; er schichtet die Äste in der Mitte auf und verbrennt sie. Dann pflanzt er in der Asche Mais oder Maniok an. Die Asche hilft ihm dabei auf zweierlei Weise: Sie gibt Nährstoffe ab, und sie neutralisiert die zumeist sauren Böden für eine gewisse Zeit. Hat der Bauer das Land für zwei, drei Jahre bebaut, muss es anschließend für mindestens 20 bis 30 Jahre brach liegen. Erst dann sind die Bäume so weit nachgewachsen, dass der Bauer das Land erneut nutzen kann. Das Landwirtschaftssystem der Chitemene funktioniert folglich nur bei einer sehr geringen Bevölkerungsdichte.
Tatsächlich ist Sambia insgesamt dünn besiedelt. Nur: Die meisten Kleinbauern leben entlang der wenigen Straßen; und dort sind die Flächen dicht besiedelt. Die Ackerböden werden deshalb immer stärker ausgelaugt.
Das Gleiche gilt für Mosambik: „Die Bauern hier verbrennen das Gras auf ihren Feldern, obwohl sie wissen, dass es den Böden schadet", sagt im Städtchen Lichinga im Norden des Landes der Förster Alfred Muchanda. Leider seien solche Praktiken kulturell tief verwurzelt. „Die Bauern glauben, dass sich während des feuchten Sommers böse Geister auf ihren Nutzflächen einnisten. Diese brächten Krankheiten über die Menschen, Pech in der Landwirtschaft und im Geschäft und alle möglichen Katastrophen. Um die bösen Geister zu vertreiben, sagen sie, müsse man, sobald das Gras trocken genug sei, die Felder abbrennen." Gegen solche tief verwurzelten Einstellungen richte man mit rationalen Argumenten wenig aus, klagt Muchanda.
Rinder als Sparbüchse
Sambia und Mosambik verfügen über riesige natürliche Weideflächen. Deshalb könnte man mit Rinderwirtschaft gutes Geld verdienen. Im Grasland Mosambiks ist jedoch fast überhaupt kein Vieh zu sehen. Es fehle der kulturelle Bezug, sagen Experten. In Sambia gibt es zwar große Herden, aber die werden kaum wirtschaftlich genutzt, klagt Mick Mwala, Professor und Agrarexperte an der Universität von Lusaka.
Rinder besäßen in Sambia weniger einen wirtschaftlichen als einen sozialen und kulturellen Wert, erklärt Mwala. „Je mehr Tiere du hast, desto angesehener bist du. Ein Bauer verkauft ein Rind nicht auf dem Höhepunkt seines wirtschaftlichen Werts, sondern meist erst dann, wenn es uralt ist und kaum noch Geld einbringt." Kurz: Rinder sind in Sambia, wie in etlichen anderen Ländern Afrikas, eher eine Art Sparbüchse. Man gewinnt Prestige daraus und hat eine Reserve, wenn die Feldfrüchte einmal gar nicht gedeihen. Ein gutes Tier verkauft der Bauer allenfalls dann, wenn er den Schulbesuch eines Kindes oder eine Hochzeit finanzieren muss.
Daraus folgt: So, wie die Kleinbauern Sambias und Mosambiks bis heute arbeiten, können sie von ihrer Landwirtschaft nicht leben. Deshalb nutzen sie ihren Lebensraum, die Waldsavanne, auch in anderer Weise: Sie sammeln Früchte, Kräuter, medizinische Pflanzen und Brennholz; sie jagen, und sie fällen Bäume, um aus dem Holz Kohle zu produzieren.
Entlang der Straße zwischen Lusaka und Mumbwa reiht sich Kilometer an Kilometer verwüstetes Land voller Baumstümpfe; Ziegelöfen rauchen; Hunderte hoch mit Holzkohle beladene Fahrräder und Lastwagen fahren vorbei. Holzkohle koste in der Stadt hier 50 bis 60 Dollar pro Tonne, berichtet George Allison. „Sie ist damit die bei weitem billigste Energiequelle in Sambia. Eine Folge: Sambia ist heute das Land mit der höchsten Entwaldungsrate pro Kopf weltweit. Ein Großteil der Holzkohle wird auch nach Tansania und nach Malawi exportiert.
Jagen mit Feuer
Auch Mosambik verliert Jahr für Jahr mehrere hunderttausend Hektar Wald an die Flammen. Hier ist, neben der Holzkohleproduktion, die Jagd mithilfe von Feuer verbreitet. Eine Fahrt von Nampula im Norden nach Gurúe führt über Dutzende Kilometer durch dichten Rauch; an den Hügeln ringsum sind zahlreiche, meist ringförmige Feuer zu sehen. „So jagen wir Ratten", sagt der Fahrer. „Wir legen einen Kreis aus Feuer um ein Stück Land; die Ratten dort rennen in die Mitte, einige verbrennen, die meisten ersticken. Und wir können sie am nächsten Tag einsammeln."
Carlos Malita, Leiter einer lokalen Hilfsorganisation in Gurúe, schüttelt den Kopf. „Die Leute hier haben keine Vorstellung davon, welchen Schaden sie mit ihrer Feuerjagd anrichten: Sie vernichten auf einer großen Fläche alles Leben. Gerät das Feuer außer Kontrolle, brennen sie bisweilen sogar ihre eigenen Häuser nieder." Die Folgen sind an den kahlen Berghängen rings um Gurúe zu sehen. Nachdem jahrzehntelange Feuerjagd den Wald dort vernichtet hatte, hat der Regen die entblößten Böden einfach fortgespült.
Viele Kleinbauern im südlichen Afrika ahnen, dass sie ihre Produktion vervielfachen, Armut überwinden und Entwicklung in Gang bringen könnten. „Aber wir sitzen wie unter einem Tisch", sagt einer. „Und wollen wir aufstehen, stoßen wir mit dem Kopf gegen die Tischplatte." – Was den Bauern fehlt, liegt auf der Hand: zuallererst qualifizierte Beratung; außerdem ertragreiches Saatgut, Dünger und Pflanzenschutzmittel; Zugang zu modernem Gerät, Bewässerungssystemen und Märkten; zu Strom und Krediten.
Kurz, ein gewaltiges Paket an Hilfsmitteln wäre notwendig, damit Kleinbauern im südlichen Afrika zu Profis in effizienter Landwirtschaft werden. Aber darum haben sich die herrschenden Eliten nie gekümmert. Die Agrarbudgets der Regierungen seien mager, sagt in Lusaka Professor Mwala. Und sie beständen im Wesentlichen aus Personalkosten und Subventionen, die viel kosten, aber nichts bringen. „Sinnvolle Subventionen müssen ein klar definiertes Ziel haben – eine Notlage zu überbrücken oder einen Sektor mit viel Potenzial anzuschieben –, und sie müssen zeitlich begrenzt sein", erklärt Mwala. Sambias Agrarsubventionen aber hätten kein Ziel. Sie machten nur die Bauern vom Staat und von populistischen Politikern abhängig. Diesen sei es egal, ob sie landwirtschaftliche Märkte verzerren und so die Entwicklung einer gesunden Landwirtschaft verhindern.
Wenig Gutes ist vor Ort auch über die seit Jahrzehnten tätigen internationalen Hilfsorganisationen zu hören. „Im Rahmen eines auf drei Jahre befristeten Projekts bieten sie den Bauern die eine oder andere Ressource" an, erklärt eine UN-Expertin in Sambia. „Sie bieten aber praktisch nie ein sinnvolles Gesamtpaket an." Seit 50 Jahren wiederholten Hilfsorganisationen immer gleiche oder ähnliche Agrarprojekte und verkauften sie als innovativ, kritisiert auch Rudy van Gent, bis vor kurzem Agrarexperte der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Sambia. Tatsächlich habe man sich nur im Kreise gedreht, ohne das Leben der Menschen wirklich zu ändern: „Wenn Sie die Projekte solcher Organisationen nach fünf oder zehn Jahren anschauen, dann sehen Sie so gut wie nichts mehr davon, was die Millionen investierten Dollar bewirken sollten."
Lösungsansätze
Was also tun? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, den Bauern im südlichen Afrika aus ihrer Hunger-Landwirtschaft herauszuhelfen? Agrarexperte George Allison weiß zumindest, was die Bauern technisch tun sollten: „Um die ausgelaugten und sauren Böden wieder fruchtbar zu machen, muss man sie mit Kalk neutralisieren. Man muss systematisch düngen und das Bodenleben möglichst wenig stören, also auf gar keinen Fall den Pflug einsetzen." Pflügen vernichte zwar Unkraut, aber es lasse zugleich alles organische Material oxydieren und den Kohlenstoff verschwinden. „Es verschlechtert also dramatisch die Qualität der Böden – speziell hier im südlichen Afrika."
Die Alternative zum Pflug ist der Grubber, der in Sambia als Magoye Ripper angeboten wird, ein Gerät, das schmale Furchen in den Boden schneidet, in die Saatgut und Dünger eingebracht werden. Dieses Gerät ist Teil der so genannten konservierenden Landwirtschaft, die heute in Brasilien, Argentinien, Australien und den USA weit verbreitet ist. Zu den Prinzipien der konservierenden Landwirtschaft zählt auch, dass der Ackerboden stets mit organischem Material, vor allem mit Ernteresten, bedeckt bleiben soll. So ist er vor Erosion durch heftigen Regen, Wind und Temperaturwechsel geschützt und kann Wasser und Nährstoffe halten.
Wichtig sei überdies, dass der Bauer Fruchtwechsel betreibe – etwa zwischen Getreide und Soja, erklärt Allison. Die eine Pflanze führe dem Boden Nährstoffe zu, die die andere brauche: „Sojabohnen, zum Beispiel, binden bis zu 200 Kilogramm Stickstoff pro Hektar. Nach der Sojaernte kommt der in den Wurzeln enthaltene Stickstoff der nächsten Pflanze zugute; das kann zum Beispiel Weizen oder Gerste sein."
Konservierende Landwirtschaft ist allerdings keine strikt ökologische Landwirtschaft. „Das kann sie unter den natürlichen Bedingungen im südlichen Afrika einfach nicht sein", meint Vince Hodson, ein Agrarexperte der in Sambia aktiven Conservation Farming Unit. Kleinbauern könnten hier weder auf Mineraldünger verzichten noch ohne chemische Pflanzenschutzmittel auskommen.
Unkrautbekämpfung ist in Afrika traditionell die Arbeit von Frauen und Kindern. Viele dieser Kinder fangen um fünf Uhr früh an, Unkraut zu jäten – eine überaus anstrengende Arbeit. Gehen die Kinder anschließend zur Schule, sind sie zu müde, um noch aufzupassen. Außerdem verliert der Bauer – trotz aller Kinderarbeit – immer wieder den Kampf gegen das Unkraut. Blitzschnell, so Hodson, überwuchere es einen Teil seines Ackers und ersticke die Nutzpflanzen.
„Gerade vor Beginn einer Pflanzsaison müssen Bauern ihre Felder schnell unkrautfrei machen, um aussäen zu können. Um aber fünf Hektar Unkraut manuell zu jäten, braucht der Bauer 20 bis 30 Arbeitstage und sät anschließend zu spät aus", sagt Hodson. Mit Herbiziden dagegen benötige der Bauer für die gleiche Fläche einen Tag und könne rechtzeitig aussäen.
Bis heute jedoch haben die wenigsten Kleinbauern im südlichen Afrika Zugang zu jenen vielfältigen Ressourcen, die sie brauchen, um sich mit moderner konservierender Landwirtschaft eine solide Existenzgrundlage zu erarbeiten. Und so betreiben sie weiter traditionellen Brandrodungsfeldbau. In einem sich verhängnisvoll beschleunigenden Rhythmus brennen sie Wald, Grasland und ihre Felder ab. Sie hacken, pflügen, plagen sich ab – für beinahe nichts.
Thomas Kruchem bereist als Journalist regelmäßig Entwicklungsländer. Sein aktuelles Buch „Land und Wasser: Von der Verantwortung ausländischer Agrarinvestoren im Süden Afrikas" wurde von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) bei Brandes & Apsel 2013 herausgegeben. Kruchem hat mehrfach den Medienpreis Entwicklungspolitik des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) erhalten. thomas.kruchem@gmail.com