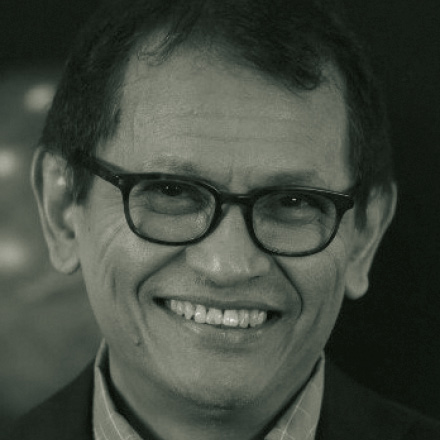Internationaler Währungsfonds
Zurück zum alten Auftrag

Ende 2015 stimmte der US-Kongress nach fünf Verhandlungsjahren endlich der Reform der Gewichtung einzelner Länder im IWF zu. Schwellenländer wie China werden dem Fonds mehr Geld geben und entsprechend mehr Stimmkraft bekommen. Europas Einfluss nimmt dagegen ab.
Lange hing die Sache im Senatsausschuss für auswärtige Angelegenheiten fest. Präsident Barack Obama war für die Reform – und einige Republikaner auch. Die Mehrheit der konservativen Politiker im Kongress sieht den IWF jedoch als sozialistische Institution, die bankrotte, US-kritische Regierungen rettet. Anderswo in der Welt hält man dagegen den IWF für ein Machtinstrument der USA.
Die aktuelle Reform wird Chinas Stimmenanteil von 3,8 auf sechs Prozent erhöhen. China wird das drittmächtigste Land nach den USA und Japan – wobei Washington einige Vetomöglichkeiten behält. Welche Mitsprache ein Mitgliedsstaat im IWF hat, soll den jeweiligen politischen und wirtschaftlichen Einfluss widerspiegeln und wird auf komplexe Weise berechnet.
Die Mission des IWF
Der IWF wurde 1944 kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs auf der Bretton-Woods-Konferenz konzipiert. Alle 44 alliierten Länder waren beteiligt. Es sollte ein neues internationales Währungssystem für die Nachkriegszeit entworfen werden. Der Goldstandard der Vorkriegszeit hatte sich als Deflationstreiber erwiesen und zur Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre beigetragen.
Seinerzeit war die einzige bekannte Alternative zum Goldstandard die willkürliche Bestimmung von Wechselkursen durch Staaten. Die Weltwirtschaftskrise verschärfte sich aber, als Regierungen darin wetteiferten, ihre Währungen abzuwerten. Sie hofften mit mehr Exporten die heimische Arbeitslosigkeit zu senken.
Um solche Währungskriege künftig zu verhindern, schlug Bretton Woods ein System fester Wechselkurse vor. Länder durften demnach ihre Wechselkurse nur ändern, wenn das grundlegendem wirtschaftlichem Wandel entsprach. Ein Teil des IWF-Auftrags war also, nationale Selbsteinschätzungen zu bewerten und zu beurteilen, ob Wechselkursänderungen gerechtfertigt waren. Dafür musste der Fonds unparteiisch sein, weshalb alle Länder entsprechend ihrer weltwirtschaftlichen Bedeutung repräsentiert sein sollten.
Das war aber nicht die gesamte IWF-Mission. Klar war nämlich, dass es Zeit kosten würde, bis ein Land nach Zahlungsbilanzproblemen wieder zum Gleichgewicht von Ein- und Ausfuhren käme. So lange sollte der Fonds ihm die Finanzierung unverzichtbarer Importe mit kurzfristigen Krediten ermöglichen. Der IWF wurde also zu einer Art Wirtschaftsforschungsinstitut mit angeschlossener Bank. Die Stimmrechte der Länder spiegelten ihren Anteil am Fondskapital wider.
Für langfristige Kredite schlug Bretton Woods eine Bank vor. Sie wurde als Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung geschaffen und als „Weltbank“ bekannt. Schon bald unterstützte sie Entwicklungsländer, von denen viele nach dem Zweiten Weltkrieg unabhängig wurden.
Strukturanpassung
Ursprünglich sollte der IWF vor allem ein Zahlungssystem für den Handel zwischen Industrieländern verwalten. In den frühen 1970er Jahren kollabierte das feste Wechselkurssystem jedoch, und der Fonds begann, sich auf Entwicklungsländer zu konzentrieren.
Diese kämpften mit besonderen Schwierigkeiten. Industrieländer kamen nach Krisen mit IWF-Unterstützung in sechs bis 12 Monaten wieder auf die Beine. Meist mussten sie nur die Haushaltsdefizite reduzieren und die Leitzinsen erhöhen, um wieder zurechtzukommen.
Die Entwicklungsländer hatten aber größere Probleme. Der IWF hielt Strukturreformen für nötig. Aus rohstoffbasierten Volkswirtschaften mit großen öffentlichen Sektoren sollten florierende industrielle Volkswirtschaften werden. Strukturanpassung bedeutete, den Staat zu verkleinern, die Wirtschaft zu deregulieren, Staatsbetriebe zu privatisieren, Arbeitsmärkte zu liberalisieren et cetera. Dass derlei in reichen Ländern auch für konservative Spitzenpolitiker wie Margaret Thatcher und Ronald Reagan vorrangig war, ist bestimmt kein Zufall.
Da Strukturanpassungen viel Zeit erfordern, formulierten IWF und Weltbank gemeinsame Programme für einzelne Länder. Sie überwachten deren Umsetzung streng und ignorierten abweichende Meinungen darüber, was Entwicklung fördern könnte.
Diese Strategie erreichte in den 1990er Jahren ihren Höhepunkt. Am Ende war aber klar, dass das Konzept in vielen Ländern gescheitert war. Statt gestärkt aus der Krise hervorzugehen, waren ganze Volkswirtschaften in Staatsschulden versunken. In der Asienkrise litt der Ruf des IWF besonders. Beobachter urteilten, er habe alles noch verschlimmert. Am Ende des Jahrzehnts sahen selbst die Regierungen der führenden Wirtschaftsmächte ein, dass Schuldenerlass für hochverschuldete arme Länder unumgänglich geworden war (siehe Beitrag von Jürgen Kaiser).
Wiedergewonnene Bedeutung
Nach der Jahrtausendwende machte der IWF zunächst nicht viel von sich reden. Einige sagten ihn tot und Experten diskutierten über seine Schließung. Doch es kam anders; der IWF gewann wieder an Bedeutung.
Das Comeback begann Ende 2007, als Dominique Strauss-Kahn die Leitung übernahm und bald darauf Olivier Blanchard zum Chefvolkswirt berief. Unter dieser Führung korrigierte der Fonds seine vorherigen Konzepte und den dogmatischen Marktliberalismus. Die IWF-Positionen zu Dingen wie der Effizienz von Kapitalverkehrskontrollen und anderen makroökonomischen Intervention änderten sich.
Die Pleite der Investmentbank Lehman Brothers löste 2008 die globale Finanzkrise aus. Das Umdenken des IWF entsprach der neuen Situation – und ganz offensichtlich wurde der Fonds noch gebraucht. Nach Srauss-Kahns peinlichem Sexskandal übernahm Christine Lagarde 2011 das Ruder, behielt aber seine Politik weitgehend bei.
Hauptaufgabe des IWF ist es nun wieder, in Krisen kurzfristig Hilfe zu leisten, um Volkswirtschaften einen Neustart zu ermöglichen. Das ist sinnvoll. Leider ist der IWF aber in die zähe Euro-Krise verstrickt (siehe Kasten). Was in Europa geschieht, erinnert vielmehr an die alte Strukturanpassungspolitik als an aktuelle Positionen der IWF-Ökonomen.
Fernando J. Cardim de Carvalho ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universidade Federal do Rio de Janeiro.
fjccarvalho@uol.com.br