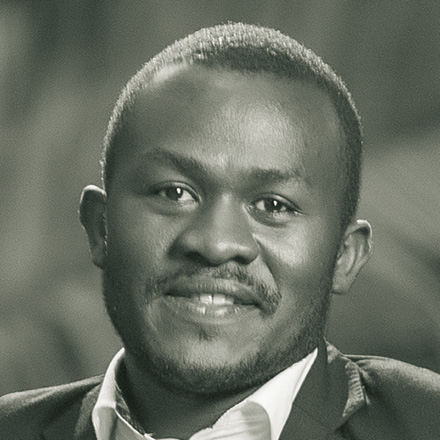Identitätspolitik
Warum Kenias Präsident sich mit seinem Vize überworfen hat

Die beiden mächtigsten Politiker Kenias, Präsident Uhuru Kenyatta und sein Stellvertreter William Ruto, stehen in einem potenziell gefährlichen politischen Konflikt. 2017 wurden sie gemeinsam für eine zweite Amtszeit wiedergewählt. Ihr Bündnis galt als Einigungspakt zwischen den Kikuyu, Kenyattas Ethnie, und den Kalenjin, Rutos Ethnie. Doch nun intrigieren die beiden Anführer gegeneinander, und alte Stammesrivalitäten leben auf.
Als Kenyatta im Vorfeld des Wahlkampfes 2022 einen „nationalen Einigungspakt” mit Oppositionsführer Raila Odinga von der Ethnie der Luo ankündigte, ließ er Ruto und die Kalenjin außen vor. Das Gespann Kenyatta-Odinga hat einen historischen Vorläufer: 1963 wurden die Väter von Kenyatta und Odinga Präsident und Vizepräsident der ersten unabhängigen Regierung Kenias nach der Kolonialherrschaft.
Die neue Kenyatta-Odinga-Allianz will mehr sein als eine Umgruppierung von ethnischen Koalitionen und gibt vor, die nationale Einheit als Ziel zu haben.
Nachdem die neue Allianz per Handschlag besiegelt war, schlugen Kenyatta und Odinga eine massive Verfassungsänderung vor, auch um „einen Wahlkampf zu fördern, der auf Ideen, Werten und unserer gemeinsamen Menschlichkeit basiert – und nicht auf dem gemeinsamen Feindbild, der Identitätspolitik, das unsere Wahlzyklen bisher bestimmt hat.”
Auch wollen Kenyatta und Odinga die Verwaltung dezentralisieren, für „mehr Inklusivität, Fairness, Gleichheit und Verantwortlichkeit bei der Verteilung von Ressourcen”. Odinga schlägt zudem eine „rotierende Präsidentschaft” vor, wodurch jede Ethnie die Chance bekomme, das Land zu führen. Zynischerweise ist Kenias Verfassung erst 10 Jahre alt und wurde eingeführt, nachdem das Land Anfang 2008 nach Wahlen traumatische Gewalterfahrungen gemacht hatte. Damals starben bei Kämpfen und Polizeieinsätzen mehr als 1000 Menschen.
Kein exklusiver Anspruch auf die Präsidentschaft
Im Januar 2021 verkündete Kenyatta, die Kikuyu und Kalenjin hätten kein Vorrecht auf die Präsidentschaft. „Vielleicht ist es nun an einer anderen Gemeinschaft, die Macht zu übernehmen,” sagte er. Diese Aussage wurde gemeinhin als Angriff gegen Ruto verstanden.
Ruto schoss zurück und sagte, Politik solle sich auf Wichtigeres als den Tribalismus konzentrieren. „Jeder soll Wahlkampf auf Basis einer Politik führen, die das Leben der Kenianer verändern wird”, forderte er. Ruto bezog sich damit auf die jungen Leute, die kritisieren, dass Politiker über ethnische Fragen reden statt darüber, worum es wirklich geht: Geld und Lebensunterhalt. Rutos Kommentar wurde als Seitenhieb gegen das neue Kenyatta-Odinga-Bündnis interpretiert.
Es geht offensichtlich um ethnische Zugehörigkeit. Die Führer mögen darüber diskutieren, dieser weniger Bedeutung beizumessen – aber sie sind weit davon entfernt, sie abzuschaffen.
Stammesdenken überwinden
Das gab sogar Kenyatta selbst zu, als er im Oktober 2020 eine Verfassungsreform vorschlug. Es werde schwer sein, das mit dem Tribalismus verknüpfte Belohnungssystem zu ändern, sagte er.
„Es ist eine Tatsache, dass wir eine Stammesgesellschaft sind, und das treibt uns auseinander.“ Und: „Wir tun so, als wären wir Landesführer. Ist es dann aber so weit, sprechen wir unsere Stammessprache und werden wieder, wer wir sind.“ Er gab zu, selbst davon nicht ausgenommen zu sein.
Und tatsächlich: Als Ruto Anfang 2021 seine Unterstützer als Opposition gegen das neue Kenyatta-Odinga-Bündnis mobilisierte, wandte sich der Präsident an Radiosender, die in seiner Sprache senden. Dabei sprach er, wie bereits zuvor, nur seine Leute an, die Kikuyu. Sofort gab es wieder Unmut wegen der „Vorrechte der Kikuyu“.
Das alles ist nicht neu. Bisweilen führen die interethnischen Spannungen zu Gewalt, besonders bei Wahlen. Zu viel Begünstigung steht auf dem Spiel. Ethnische Zugehörigkeit entscheidet darüber, ob jemand einen Job oder Regierungsauftrag bekommt oder eine Region neue Straßen, neue Kliniken oder andere wichtige Infrastruktur.
Zwei dominante Ethnien
Es gibt mindestens 44 Ethnien im Land, doch zwei dominieren und besetzen 40 Prozent der öffentlichen Stellen – die Kikuyu und die Kalenjin. Nicht zufällig gehörten alle Präsidenten seit Kenias Unabhängigkeit diesen beiden Ethnien an. Wie jeder weiß, nutzen Regierungsbeamte ihre Position, um ihre jeweiligen Gemeinschaften zu begünstigen.
Hätten Kenias Führer nach Ende der britischen Kolonialzeit 1963 einen besseren Job gemacht, wären ethnische Fragen kein Thema mehr. Stattdessen ist Tribalismus in Kenia heute das, was vor der Unabhängigkeit der Rassismus war – er wird aufrechterhalten durch informelle Strukturen mit Netzwerken, die das System für Machthaber profitabel machen.
Und so bleibt ethnische Zugehörigkeit entscheidend. Diese Ansicht ist tief verwurzelt und schwer abzustreifen. Tribalismus setzt sich durch unterbewusste Zeichen, Anspielungen, kodierte Sprache, Stereotype und offene kulturelle Verunglimpfung fort. Hassreden nachzuweisen ist schwierig und somit nicht unbedingt strafbar. Wer zur Zielscheibe wird und das anprangert, wird oft selbst des Tribalismus bezichtigt.
Rebellierende Jugend
Doch es gibt Anzeichen dafür, dass weniger auf ethnische Zugehörigkeit gesetzt werden soll. Kenyatta und Odinga fordern zumindest theoretisch ein Ende der Identitätspolitik – ihre Taten sprechen allerdings eine andere Sprache. Ihr neuer Ruf nach Einheit könnte auch ein Deckmäntelchen für Rutos Ausschaltung sein. Immerhin ist eine Debatte darüber entfacht, faire Chancen für alle zu avisieren.
Vielversprechender ist das Aufkommen einer Jugendbewegung. Die Jungen fordern das Ende identitätsbasierter Begünstigung und wollen Chancen für alle (siehe Kasten). Ruto nimmt sich ihrer Sache an und argumentiert, es sei wichtiger, über Fairness und Chancen zu diskutieren als über Verfassungsreformen.
Er versucht, die kenianische Jugend als potenziell riesige Wählerschaft für sich zu gewinnen. Schätzungsweise 75 Prozent der Bevölkerung sind jünger als 35. Viele haben Grund- und Sekundarschulbildung, müssen sich aber im informellen Sektor durchschlagen. Sie sind weniger gewillt als ihre Eltern, an das Narrativ zu glauben, diese oder jene Ethnie sei schuld an der Misere. Sie wenden sich zunehmend ab von kulturellen Vorurteilen, fingierten ethnischen Animositäten und der bestehenden Strategie des Teilens und Herrschens.
Zentrale Frage
Laut Ruto besteht die echte politische Kluft zwischen denen, die sich hocharbeiten, und denen, die Privilegien und Reichtum erben. Entscheidend sei fairer Zugang zu Land, Jobs und Chancen. Fairer Zugang hieße etwa, dass auch von der Opposition dominierte Regionen ihren Anteil an Straßen, Kliniken, Stromleitungen und sonstiger Infrastruktur erhalten.
Die zentrale Frage ist, wie faire Verteilung zu erreichen ist. Es gibt bereits Gesetze und Institutionen zum Schutz vor ethnischer Diskriminierung. Es gibt sogar eine „Nationale Kommission für Zusammenhalt und Integration“ – eine Regierungsbehörde, die Vielfalt und Integration fördert.
Letztlich besteht Diskriminierung fort, weil der Glaube, die eigene Gruppe sei besser als „die anderen“, tief sitzt. So gesehen, ähneln ethnische Vorurteile dem Rassismus; der Glaube, die eigene Gruppe sei überlegen, verstetigt Ungerechtigkeit. Dieser Glaube ist über einen Prozess der öffentlichen Erziehung beizulegen – und indem Bestrebungen nach Gleichheit und Fairness in bestehenden Gesetzen umgesetzt werden. Mehr Gesetze und eine große Verfassungsreform zur falschen Zeit werden das nicht erfüllen.
Alphonce Shiundu ist ein kenianischer Journalist, Redakteur und Faktenchecker in Nairobi.
shiunduonline@gmail.com
Twitter: @Shiundu
Normal 0 21 false false false EN-GB X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-GB; mso-fareast-language:EN-US;}