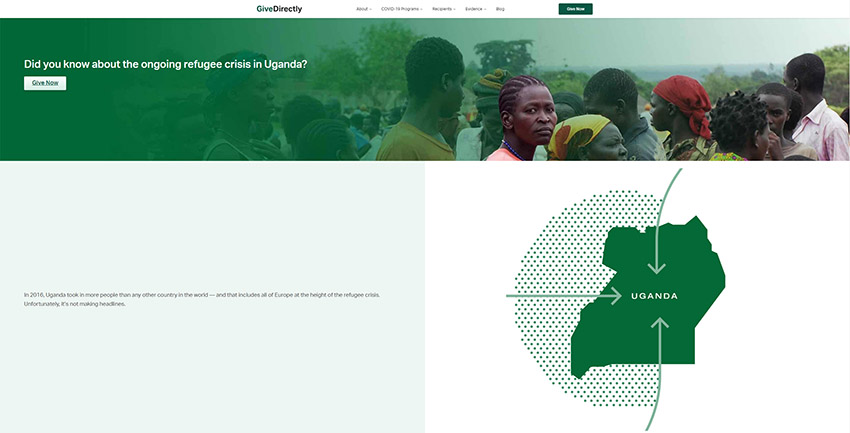Entwicklungspolitik
Chancen und Risiken der Digitalisierung

Der digitale Wandel wirkt sich weltweit auf Bildung, Gesundheit, ländliche Entwicklung, Regierungsführung und wirtschaftliche Entwicklung aus – und damit auf die Kernbereiche der Entwicklungspolitik. Es ist beindruckend, was einzelne Lösungen wie etwa das mobile Bankensystem M-Pesa in Kenia bewirkt haben. Gerade dort, wo Infrastruktur fehlt, bieten digitale Technologien neue Möglichkeiten – auch für Entwicklungsprojekte. Sie können die Menschen vor Ort oft schneller und kostengünstiger erreichen.
Die Digitalisierung kann Transparenz und Partizipation der Zivilgesellschaft begünstigen und so ihren Einfluss stärken: In zahlreichen Städten – von Accra bis Manila – vereinen sich junge Programmierer und Unternehmer, die mit digitalen Lösungen lokale Probleme beheben. Aktivisten ziehen ihre Regierungen über soziale Medien zur Rechenschaft (siehe dazu auch Artikel von Isaac Sagala auf unserer Website). Länder wie Mexiko oder Kambodscha schließen sich Open-Government-Initiativen an und legen ihre Regierungsdaten offen. Auch entwicklungspolitische Organisationen fördern als Mitglieder der International Aid Transparency Initiative (IATI) transparente und offene Strukturen.
Gleichzeitig bieten digitale Technologien nicht nur Chancen. Sie bergen auch Risiken wie unabsehbare Abhängigkeiten, etwa wenn multinationale Unternehmen wie aktuell Facebook und Google quasi im Alleingang den Aufbau von Infrastruktur in den ärmsten Ländern dieser Welt übernehmen wollen. Netzpolitische Fragen – etwa zur Netzneutralität – gehen damit ebenfalls einher.
Nicht zuletzt verdeutlichen die Enthüllungen des US-Amerikaners Edward Snowden über die umfassende Überwachung von privaten Telefonaten durch US-Geheimdienste, dass Menschenrechte zunehmend auch in der digitalen Sphäre missachtet werden. Ein weiteres Beispiel dafür ist die Verhaftung und anhaltende Misshandlung des saudi-arabischen Bloggers Raif Badawi, der sich auf seinem Blog kritisch über den Islam äußerte. Auch andere Beispiele illustrieren den schmalen Grat zwischen Chancen und Risiken der digitalen Technik: Wenn etwa die Türkei syrischen Flüchtlingen über biometrische IDs eine formelle Identität gibt, erleichtert das die Arbeit humanitärer Helfer. Wenn diese Daten jedoch gleichzeitig ausgewertet werden, um potenzielle Terroristen zu entlarven, ist dies ethisch und mit Blick auf den Datenschutz durchaus bedenklich.
Fortschritt in den eigenen Reihen
Um glaubhaft gegenüber Partnerländern auftreten zu können, müssen entwicklungspolitische Organisationen die digitale Fortschrittlichkeit auch in den eigenen Reihen beweisen. Schweden, Großbritannien und die USA haben bereits vor vielen Jahren die Digitalisierung im eigenen Land zur Chefsache erklärt und umfangreiche nationale Reformen zur Digitalisierung der Behörden angestoßen. Davon profitierten auch die Entwicklungsinstitutionen. Sie haben so sukzessive die Nutzung und Auseinandersetzung mit digitalen Technologien sowohl innerhalb der eigenen Organisation als auch in der Arbeit mit den Partnerländern verankert (siehe Kasten).
Die deutsche Bundesregierung hat sich bislang nur zögerlich dem digitalen Wandel zugewandt. Während sich dieser in hoher Geschwindigkeit vollzieht und unsere Lebenswelt drastisch verändert, sind Verwaltungen beispielsweise hierzulande noch weitgehend analog. Im letzten internationalen E-Government Index belegte Deutschland nicht einmal einen Platz unter den Top 20. Deutschland ist auch im Gegensatz zu vielen Partnerländern nicht Mitglied bei der Open Government Partnership. Dies ist eine internationale Allianz von 69 Ländern, die sich einem neuen Regierungsverständnis verschreibt und dazu die Zivilgesellschaft mit Hilfe digitaler Technologien und der Öffnung von Regierungsdaten einbindet.
Nur wer sich der Digitalisierung gegenüber öffnet und neue Technologien nutzt, kann deren Potenziale und Risiken einschätzen. Die deutschen Entwicklungsorganisationen haben dies inzwischen erkannt und im vergangenen Jahr entsprechende Maßnahmen ergriffen. Ein Ergebnis ist etwa ein vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) aktuell erarbeitetes Toolkit, das deutschen Organisationen die wichtigsten Trends und Ansätze des Themas näherbringen soll. Das BMZ plant außerdem, den Etat für Digitalvorhaben in Afrika von 2 Millionen Euro 2015 auf 53 Millionen Euro in diesem Jahr aufzustocken.
Neue Partnerschaften und Ansätze
Grundsätzlich ist es gerade in einem sich schnell wandelnden Feld wie der Digitalisierung essenziell, den Erfahrungs- und Wissensaustausch mit anderen Ländern zu suchen und gemeinsame Standards und Lösungen zu entwickeln. Schon aus Kostengründen bietet es sich an, bestehende frei zugängliche Lösungen – wie die Open-Data-Plattform vom Department for International Development (DFID) – für den Aufbau weiterer Plattformen zu nutzen, statt das Rad neu zu erfinden. Initiativen wie die Principles for Digital Development oder die erwähnte Open Government Partnership bieten Anknüpfungspunkte für den weiteren Austausch.
Digitale Maßnahmen können oft wesentlich schneller umgesetzt und angepasst werden als analoge. Und sie können auch schneller wieder beendet werden. Eine sinnvolle Nutzung digitaler Technologien erfordert insofern oft nicht weniger als einen Kulturwandel hin zu flexibleren Prozessen. Die US Agency für International Development (USAID) baute 2014 mit enormen finanziellen Ressourcen eine neue Einheit auf: das Global Development Lab. Dieses will effizientere und kostengünstige Lösungen entwickeln, ausprobieren und je nach Erfolg umsetzen oder verwerfen. Dass sich die US-Amerikaner diesem Start-up-Ansatz verbunden fühlen, wundert mit Blick auf das Silicon Valley kaum. Sicherlich sollten sich entwicklungspolitische Akteure auf ihre (nationalen) Stärken konzentrieren. Digitale Lösungen werden auch nur begrenzt eine Antwort auf höchst komplexe entwicklungspolitische Probleme geben können. Klar ist jedoch, dass die Entwicklungspolitik mit steigendem Budget- und Effizienzdruck neue agilere und unbürokratische Wege für neue Lösungen braucht.
Der Einsatz von Technologien hat auch immer politische Implikationen. Insofern müssen beispielweise auch gewissenhaft Standards erarbeitet werden, wie digitale Menschenrechte in der Interaktion mit Menschen in den Partnerländern stetig gewährt werden können. Dafür werden Kooperationen mit Partnern wichtig sein wie zum Beispiel Forschungseinrichtungen und kleine zivilgesellschaftliche Akteure. Diese können auf schnell wandelnde Themen der Digitalisierung dynamischer und flexibler reagieren, als es für die großen Organisationen im Alltagsgeschäft möglich ist. Die kanadische Regierung etwa lässt eine große Summe an die Forschungseinrichtung International Development Research Centre (IDRC) fließen, die Forschung zu genau diesen Fragen fördert. Die niederländischen Behörden fördern über diverse Töpfe gezielt Nichtregierungsorganisationen (NGOs) an der Schnittstelle von Menschenrechten und Digitalisierung. Davon profitiert beispielsweise das Humanist Institute for Cooperation (HIVOS), eine Vorreiterorganisation zum Schutz digitaler Menschenrechte.
Herausforderungen und Chancen
Es gilt, die Potenziale der Digitalisierung zu nutzen. Gleichzeitig ist es aber genauso nötig, sich mit den möglichen Risiken auseinanderzusetzen. Die Nutzung einer SMS-Anwendung im Gesundheitsbereich kann etwa schnell negative Effekte für die Empfänger haben, wenn Datenschutz- oder IT-Sicherheitsstandards nicht eingehalten werden. Die Zusammenarbeit mit multinationalen IT-Unternehmen zur Umsetzung eines Bildungsprojektes kann die Entstehung lokaler Produkte und Inhalte verhindern.
Umso wichtiger ist es, Kompetenzen in den Organisationen auszubauen, um digitale Lösungen bewerten zu können. Ebenso kann die internationale Gemeinschaft von Deutschlands Expertise zu Themen wie dem Schutz der Privatsphäre oder dem digitalen Verbraucherschutz profitieren. Konkret könnte die deutsche Politik beispielsweise die Arbeit lokaler NGOs im Sinne eines Capacity-Building-Ansatzes unterstützen sowie zusammen mit anderen Akteuren technische Lösungen und Richtlinien zum Schutz der Privatsphäre erarbeiten.
Julia Manske arbeitet bei der Berliner Denkfabrik stiftung neue verantwortung an der Schnittstelle von Entwicklungs- und Digitalpolitik.
jmanske@stiftung-nv.de
Literatur
DFID: Digital Strategy.
https://www.gov.uk/government/publications/department-for-international-development-digital-strategy-2012-to-2015.
Smith, M. L und Reilly, K. M. A., 2013: Open Development. Networked Innovations in International Development. The MIT Press.
Hostein, G. M., und Nyst, C., 2014: Aiding surveillance. An exploration of how development and humanitarian aid initiatives are enabling surveillance in developing countries. I&N Working Papers 2014/1.