Globale Trends
Ungleichheit beim Glücksempfinden wächst weltweit
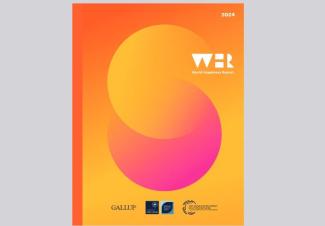
Die Suche nach Glück hört nicht auf – doch was genau Glück bedeutet, unterscheidet sich von Mensch zu Mensch. Es hängt ab von der Lebensphase, dem sozioökonomischen Status und der eigenen Position innerhalb der Demografie.
Der World Happiness Report 2024 (WHR) beleuchtet diese und verwandte Themen. Er wird jährlich veröffentlicht von Gallup, dem Oxford Wellbeing Research Centre und dem UN Sustainable Development Solutions Network sowie verschiedenen Wissenschaftler*innen als Co-Autor*innen. Er erschien zum ersten Mal im Jahr 2012.
Der diesjährige WHR analysiert den Zusammenhang zwischen Lebenszufriedenheit und Alter und berücksichtigt auch regionale Dynamiken sowie sozio-politische Faktoren. Er präsentiert zudem ein globales Länderranking und bewertet globale Trends.
Auf den Spitzenpositionen liegen weiterhin skandinavische Länder. Allgemein lässt sich sagen, dass sich glückliche Nationen durch ganzheitliche, menschenzentrierte politische Systeme auszeichnen. Sie bieten starke soziale Sicherung, wenig Korruption, wirtschaftliche Stabilität, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit und legen einen Schwerpunkt auf das Wohlbefinden der Bürger*innen. Unter solchen Bedingungen können sich Menschen entfalten. Seit dem Zeitraum zwischen 2006 und 2010 haben sich Mittel- und Osteuropa in Hinblick auf das Glücksempfinden am stärksten verbessert; dagegen ging es in Südasien und im Nahen Osten zurück. In Nordamerika fiel die Zufriedenheit bei Jugendlichen deutlich. Afghanistan belegt den letzten Platz.
Die Forschenden verwenden sechs Schlüsselfaktoren, um das Glück einer Nation zu ermitteln: BIP pro Kopf, Erwartung gesunder Lebensjahre, das Maß an sozialer Unterstützung für einzelne Bürger*innen, die Freiheit, eigene Lebensentscheidungen zu treffen, die Großzügigkeit des sozialen Umfelds einer Person und die Abwesenheit von Korruption. Weltweit ist die soziale Sicherung am stärksten ausgeprägt in den einkommensstarken Ländern Westeuropas sowie in Australien und Neuseeland. Am schwächsten ist sie in Südasien.
Die Auswirkungen von Einkommen und Gesundheit auf das Glücksempfinden liegen auf der Hand. Allerdings lassen sich Gefühle durch sie nicht vollständig erklären. Soziale Variablen sind laut dem Bericht sehr wichtig. Es spielt eine große Rolle, ob Menschen politische Freiheiten und finanzielle Möglichkeiten haben, Entscheidungen zu treffen. Ein soziales Umfeld mit starken Unterstützungsangeboten und geringer Korruption wirkt sich zusätzlich förderlich aus.
Das, was der WHR „happiness inequality“ („Ungleichheit des Glücksempfindens“) nennt, ist in den vergangenen zwölf Jahren gewachsen und nur in Westeuropa stabil geblieben. Die Unterschiede in Bezug auf die Lebenszufriedenheit haben in allen Altersgruppen zugenommen, sind jedoch bei den Älteren tendenziell größer. Besonders ausgeprägt sind sie dort, wo auch andere soziale Ungleichheiten deutlich zutage treten. Die Kluft zwischen Privilegierten und Benachteiligten ist in Lateinamerika, Südostasien und Subsahara-Afrika gewachsen, und das gilt auch für die Ungleichheit des Glücksempfindens. Westeuropa weist in allen Altersgruppen die niedrigsten Unterschiede auf. Im Allgemeinen wird eine größere Gleichheit beim Glücksempfinden mit einem höheren allgemeinen Wohlbefinden in Verbindung gebracht. Das unterstreicht die Bedeutung von Einkommen, Bildung und sozialer Sicherung.
Ein zentrales Thema des WHR ist, wie sich Glücksempfinden mit dem Alter verändert. Insbesondere betrachten die Autor*innen die Situation von zwei vulnerablen sozialen Gruppen: zum einen Kinder und Jugendliche, zum anderen Senior*innen. In einkommensstarken Ländern war die Lebenszufriedenheit unter Jugendlichen in den vergangenen Jahren rückläufig; insbesondere Mädchen waren betroffen. Covid-19 hat den Abwärtstrend verschärft.
International geben Jugendliche zwischen 15 und 24 Jahren dennoch allgemein eine höhere Lebenszufriedenheit an als ältere Erwachsene. In Westeuropa ist dieser Abstand geringer; in Nordamerika, Australien und Neuseeland ist es sogar andersherum.
Der Bericht geht auch darauf ein, dass viele Gesellschaften altern. Global wird sich bis 2050 die Zahl der Personen im Alter von 65 Jahren und älter voraussichtlich verdoppeln. Eine Folge davon wird ein signifikanter Anstieg der Demenzfälle weltweit sein. Diese Behinderung ist ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig soziale Rahmenbedingungen sind. Die Forschung zeigt, dass der Zugang zu Bildung, guter Gesundheitsversorgung und dem Screening auf Symptome dabei helfen, Demenz vorzubeugen.
Der WHR erwähnt auch, dass globale Trends und internationale Ereignisse Auswirkungen auf das Glücksempfinden der Menschen haben – etwa Unwetterkatastrophen aufgrund der globalen Erwärmung, Kriege oder die Folgen des technologischen Fortschritts. Die Autor*innen verzichten allerdings darauf, hier ins Detail zu gehen. Ihr Fokus liegt auf Aspekten, die über Kulturen und Zeiten hinweg vergleichbar sind.
Khushboo Srivastava ist Politikwissenschaftlerin und Assistenzprofessorin am Tata Institute of Social Sciences in Mumbai.
krsrivastava29@gmail.com















