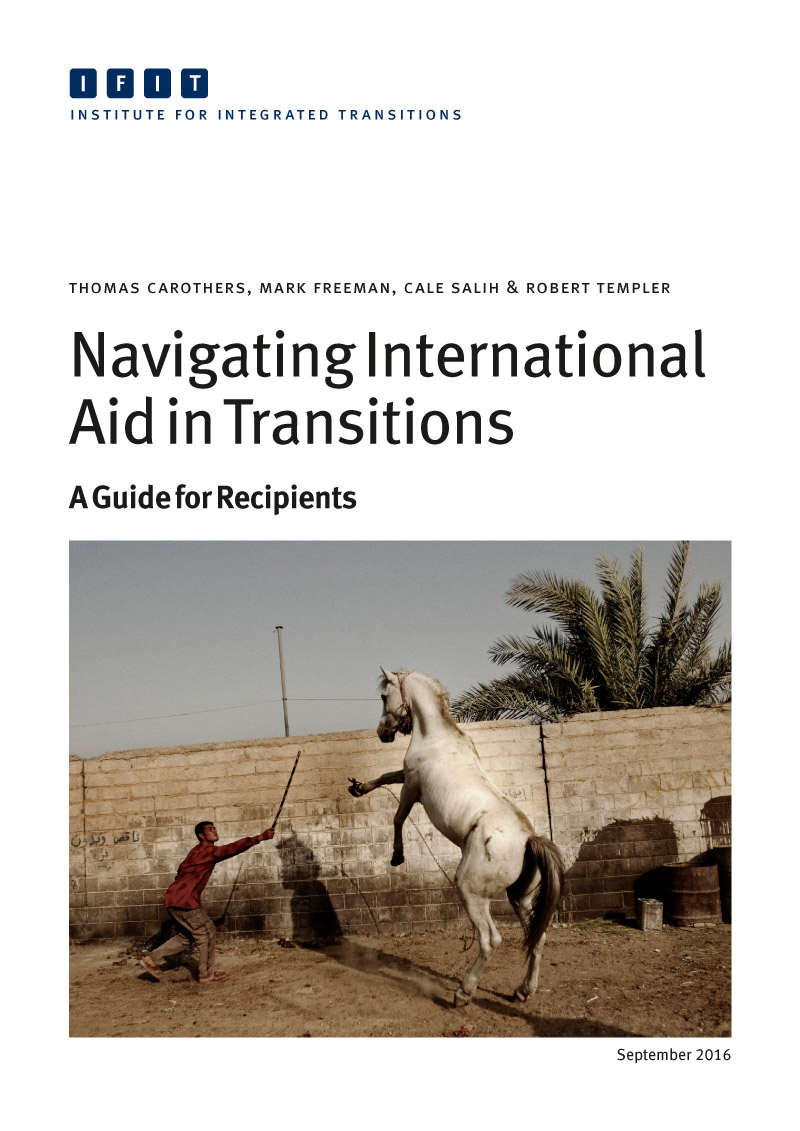Zielkonflikte
Friedensförderung

Soziale, politische und wirtschaftliche Ausgrenzungen verursachen und verstärken gewaltsame Konflikte. Friedensförderung bedeutet daher auch, Ausgrenzung abzubauen – ganz im Sinne des Ziels der Agenda 2030, niemanden zurückzulassen. „Das ist kein neues Konzept“, betont Oury Traoré, Geschäftsführerin des Madiba Institute for Leadership in West Africa, „was neu ist, ist die neue Verpflichtung dazu.“
Die internationale Staatengemeinschaft habe realisiert, dass globale Solidarität vonnöten ist. Zumal die Situation in einzelnen Ländern gar nicht mehr isoliert betrachtet werden könne. „Was in Mali passiert, kann nicht nur für Mali betrachtet werden – es hat globale Auswirkungen“, sagte Traoré auf dem Berliner Sommerdialog der Stiftung Entwicklung und Frieden.
Die Veranstaltung stand unter dem Titel „Ausgrenzung als Ursache von Gewalt. Ansätze für die internationale Zusammenarbeit“. Die Teilnehmer waren sich darüber einig, dass es oft schwierig ist, die „Guten“ und „Bösen“ zu identifizieren und Akteure zu finden, die eine positive Rolle im Friedensprozess einnehmen können. Das seien nicht in erster Linie diejenigen, die westlichen Werten am nächsten stehen, sondern diejenigen, die traditionell diese Rolle haben, betont die Bundestagsabgeordnete Ute Finckh-Krämer und warnt: „Gefährlich ist es, wenn etwa die EU einzelne Akteure oder Konfliktparteien zu Terroristen erklärt – dann sind Verhandlungen nicht mehr möglich.“
Niemanden auszuschließen, bedeutet für Traoré auch, mit unliebsamen Regierungen zusammenzuarbeiten. „Selbst in einem gescheiterten Staat muss die Regierung einbezogen werden, man kann sie nicht umgehen.“ Der Konfliktforscher Lars-Erik Cederman stellt den Bottom-up-Approach generell in Frage: „Man muss über die Regierung gehen.“ Er räumt aber auch ein, dass es Zielkonflikte zwischen Stabilisierung und Veränderung geben könne; manche Staats- und Regierungschefs nutzten Stabilisierung, um Ausgrenzung langfristig zu etablieren.
Traoré empfiehlt denen, die von außen kommen, nicht die führende, sondern eine unterstützende Rolle einzunehmen und niemanden auszugrenzen, zum Beispiel Frauen und junge Leute, die traditionell vielleicht in der Konfliktbearbeitung eines Landes keine Rolle spielen. „Wenn Sie Frauen nicht einbeziehen, werden Sie keinen Erfolg haben “, warnt Traoré. Thomas Helfen vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) stimmt ihr zu. Frauen seien oft näher an den Alltagsproblemen dran als Männer. Es sei wichtig, sie nicht nur als Opfer, sondern als Akteurinnen in Friedensprozessen wahrzunehmen.
Die Diskussion machte die verschiedenen Arten von Ausgrenzung deutlich, zum Beispiel absichtliche versus unabsichtliche, und dass für Konflikte weniger tatsächliche Ungleichheit als die Wahrnehmung von Ungleichheit eine Rolle spielt. Damit aus empfundener Ungerechtigkeit allerdings ein Bürgerkrieg wird, braucht es Ressourcen und Infrastruktur – und diese kommen häufig von außen, wie der Politologe Indra de Soysa an den Beispielen Naher Osten und Afghanistan aufzeigt. Westliche Länder beeinflussten Konflikte massiv, etwa durch die Lieferung von Waffen.
Dass sie auch vermittelnd Einfluss nehmen, beschreibt Luxshi Vimalarajah von der Nichtregierungsorganisation Berghof Foundation am Beispiel Jemen. Dort sei die internationale Gemeinschaft stark an den Friedensverhandlungen beteiligt gewesen. „Es war ein Prozess wie aus dem Lehrbuch, mit viel Inklusion“, berichtet sie. „Doch jetzt wissen wir, dass wichtige Akteure ausgeschlossen waren.“ Die Verhandlungen scheiterten, der Krieg geht weiter. Ein weiterer Grund habe darin bestanden, dass es keinen Konsens im UN-Sicherheitsrat gab.
Nach Ansicht von Aurélien Tobi vom Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstitut (SIPRI) sind unterschiedliche Ziele und Prioritäten einer der Hauptgründe dafür, dass Friedensförderung so kompliziert ist. „Wir wollen gegen Dschihadismus, Drogenhandel und illegale Migration vorgehen“, sagt er. Aber diese internationalen Ziele unterschieden sich unter Umständen stark von denen der Regierung und denen – wieder anderen – der lokalen Zivilgesellschaft. „Wir sagen dann schnell, sie haben nicht die Kapazität, nicht den politischen Willen. Aber vielleicht ist der politische Wille einfach ein anderer.“