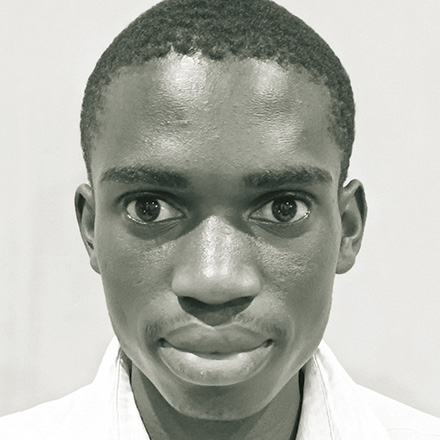Treibhauseffekt
„Abwasser ist eine Ressource“
[ Interview Thomas Kluge ]
Das Management von Wasserressourcen gehört zu Ihren Spezialgebieten. Inwiefern müssen Sie den Klimawandel bei Ihrer Arbeit berücksichtigen?
Im Wasserressourcenmanagement müssen wir uns derzeit zwei großen Herausforderungen stellen – dem demographischen Wandel und dem Klimawandel. Durch den Klimawandel verschärft sich der Wassermangel in den jetzt schon benachteiligten Gebieten. Gleichzeitig verändert sich die Bevölkerungszahl, und es wird immer schwieriger, eine ausreichende Wasserversorgung für alle zu garantieren.
Können Sie das an Beispielen verdeutlichen?
Im südlichen Afrika beispielsweise schwanken durch den Klimawandel die Niederschläge heftiger. Sintflutartige Regenfälle verbreiten Krankheiten und zerstören die Landwirtschaft, lange Dürreperioden erschweren die sanitäre Versorgung und die Versorgung mit Trinkwasser. Die Probleme in der Trinkwasser- und Nahrungsmittelversorgung verschärfen sich zusätzlich durch das rasante Bevölkerungswachstum.
Nicht überall steigen aber die Bevölkerungszahlen.
Es gibt auch Regionen, in denen die Bevölkerungszahlen sinken, wie beispielsweise in Ostdeutschland. Hier sind die Infrastrukturen – also Schulen, Krankenhäuser und eben auch die Wasserversorgung – noch auf doppelt so viele Menschen ausgerichtet. Es lohnt sich dort kaum noch, die großen und teuren Kläranlagen in Betrieb zu halten. Gleichzeitig nimmt in Teilen Ostdeutschlands die Regenmenge insgesamt ab, sodass Böden austrocknen. Da stellt sich die Frage: Kann man eine gemeinsame Lösung für beide Phänomene finden?
Und gibt es solche Lösungen?
Im Bereich der Wasserversorgung müssen wir umdenken. Die Devise muss sein: wenig Frischwasser verbrauchen, es für möglichst viele Zwecke wiederverwerten, Energie sparen, Emissionen senken. Unsere heutigen Systeme werden diesem Anspruch nicht gerecht. Sie entsprechen noch den Vorstellungen des 19. Jahrhunderts: Industrie, Landwirtschaft und Haushalte erhalten alle aufwändig gewonnenes Frischwasser. Nach Gebrauch gelangen alle Abwässer – unabhängig davon, welchen Verschmutzungsgrad sie haben – gesammelt in die Kläranlage. Diese Anlage muss in bis zu zehn Klärgängen sämtliche Arten von Chemikalien, Bakterien und groben Schmutz aus dem Wasser filtern. Das ist extrem chemie- und energieaufwändig, es ist teuer, und es gehen Stoffe verloren, die in der Landwirtschaft genutzt werden könnten. Selbst das Regenwasser, das man ganz einfach und günstig in Frischwasser umwandeln könnte, leiten wir ins Abwasser.
Wie kann ein alternatives System für Wasserversorgung aussehen?
Ein neues System muss an zwei Stellen ansetzen:
– Es muss den Verbrauch von Frischwasser senken. Frischwasser sollte nur dort verwendet werden, wo es dringend nötig ist – also für Trinken, Kochen und Hygiene. In anderen Bereichen kann man aufbereitetes Abwasser nutzen oder sparsamere Methoden anwenden, um den Wasserverbrauch zu senken.
– Versorger müssen Abwasser als Ressource behandeln, also möglichst oft weiterverwerten. Dafür müssen Abwasserströme differenziert und dezentrale Kreisläufe eingerichtet werden. Häusliche Abwässer aus Dusche, Küche, Waschmaschine – also das sogenannte Grauwasser – einer Siedlung beispielsweise können landwirtschaftlich genutzt werden. Dafür braucht es keine komplexe Kläranlage, da reichen einfache Aufreinigungsverfahren.
Wie genau funktioniert die Differenzierung von Abwasserströmen?
Differenzierung von Abwasser bedeutet, unterschiedliche Arten von Abwasser getrennt zu behandeln. Führt man beispielsweise das Grauwasser getrennt ab – also Frischwasser, das zum Duschen oder Wäschewaschen verwendet wurde – kann es mit einfachen Methoden gereinigt werden. Wird es beispielsweise mit einer Membrane wiederaufbereitet, kann es wieder wie Frischwasser verwendet werden. So wird der Frischwasserverbrauch reduziert. Grauwasser-Recycling wäre billiger als die herkömmlichen Kläranlagen, sie verbrauchen weit weniger Energie und reduzieren den CO2-Ausstoß. In Ostdeutschland könnte man mit Grauwasserkreisläufen sowohl das Problem der teuren Kläranlagen als auch die Wasserknappheit angehen.
Ist es nicht sehr aufwändig, die Abwässer der Haushalte zu trennen?
Ja. Gerade in Entwicklungsländern kann man nicht überall Grauwasser getrennt abführen, schon gar nicht in den informellen Siedlungen am Stadtrand. Stattdessen kann man jedoch das gesammelte Abwasser einer solchen Siedlung – das mit Urin und Fäkalien belastete „Schwarzwasser“ – weiter verwerten. Reinigt man das Schwarzwasser von Bakterien, so bleibt Wasser mit hohem Nitrat- und Phosphatgehalt übrig, das gut für die Landwirtschaft genutzt werden kann. Für die phosphatarmen afrikanischen Böden ist dieses Wasser gleichzeitig Düngemittel.
Können sich Entwicklungsländer die Technologien für solche Lösungen leisten?
Die verschiedenen Technologien sind unterschiedlich teuer. Allesamt verbrauchen die neuen Anlagen allerdings viel weniger Energie. Das spart Kosten: In einigen Entwicklungsländern stehen konventionelle Anlagen ohnehin still, weil die Energiekosten zu hoch sind. Außerdem können durch die Wiederverwertung von Abwasser Kosten bei Frischwassergewinnung und -transport gespart werden. Stuttgart beispielsweise bezieht sein Wasser aus dem Bodensee. Für die Aufbereitung und den Transport werden rund fünf Kilowattstunden Energie pro Kubikmeter Wasser verbraucht. Baut man dagegen einen Grauwasserkreislauf vor Ort ein, benötigt man nur 0,5 bis 1 Kilowattstunde pro Kubikmeter neu gewonnenen Wassers.
Warum kommen neue Technologien mit weniger Energie aus?
Während der Wasserreinigung wird durch Wärmetausch im Abwasserstrom oder durch anaerobe Vergärung des Wassers Energie gewonnen. So viel, dass sie den Energiebedarf der Anlage deckt. Solche Anlagen arbeiten also quasi Energie-autark.
Was bedeutet das für die Entwicklungszusammenarbeit und die „Millennium Development Goals“ (MDGs)?
In der Entwicklungszusammenarbeit sollte das Wassermanagement stärker in den Vordergrund gerückt werden. Schließlich geht es beim Wassermanagement um mehr als Ressourcenschutz. Unser Projekt in Namibia zeigt, wie durch neue Methoden der Abwasseraufbereitung nicht nur die Knappheit bekämpft wird. Die Betriebskosten für die Wasserversorgung, der Energieaufwand und die Gesundheitskosten sinken. Zudem wird durch die Erschließung neuer Bewässerungsflächen (Water Re-use) Arbeit geschaffen und Armut gesenkt. Gutes Wassermanagement leistet also auch einen fundamentalen Beitrag zu jenen MDGs, die sich auf Gesundheit und Armut beziehen. Die Entwicklungszusammenarbeit sollte viel öfter solche Maßnahmen einsetzen, die mehrere MDGs verknüpfen.
Was muss Ihrer Meinung nach zuerst getan werden?
Wir müssen bei uns anfangen. Bisher fehlen Referenzprojekte in Deutschland, die wir vorzeigen können, um anerkannt zu werden. Wir haben in Deutschland zwar die Technik und das Know-how für neue technische Lösungen, nutzen aber immer noch die großen, chemischen Aufbereitungsanlagen. Im Rahmen unseres Projekts „Networks“ hat das ISOE den Stadträten in Essen, Chemnitz und Hamburg neue Lösungen mit dezentralen Wasserkreisläufen vorgestellt. So hoffen wir, die Abwasseraufbereitung in Deutschland Stück für Stück zu verändern.
Sie engagieren sich aber nicht nur in Deutschland. Wo muss Ihrer Meinung nach die Entwicklungszusammenarbeit ansetzen?
Die Entwicklungszusammenarbeit sollte ebenfalls stärker mit der Forschung zusammenarbeiten. Sie sollte mehr auf neue Technologien in der Abwasseraufbereitung setzen, statt an den konventionellen Verfahren festzuhalten. In der Zukunft wird es immer wichtiger, Frischwasser zu sparen und den Energieverbrauch zu senken.
Die Fragen stellten Franziska Baur und Eva-Maria Verfürth.