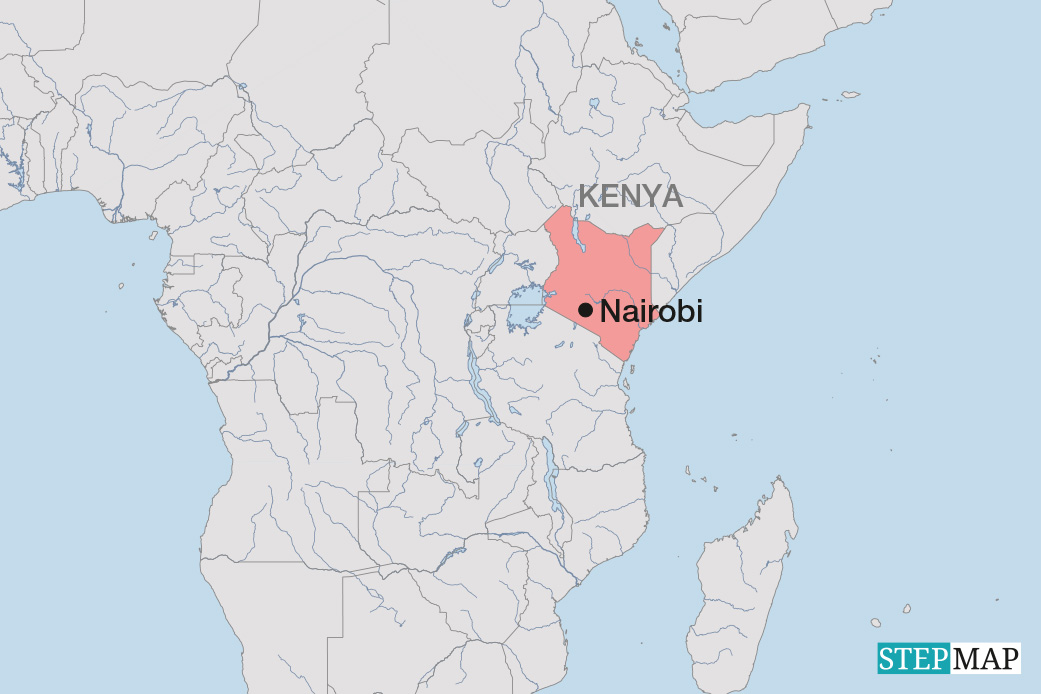Glaube und psychische Gesundheit
Wie glaubensgestützte Organisationen mentale Gesundheit fördern

Religiosität und Glauben können die psychische Gesundheit und das psychosoziale Wohlbefinden beeinflussen, sowohl positiv als auch negativ. Internationale Programme der humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit berücksichtigen dieses Potenzial allerdings erst seit rund zehn Jahren in stärkerem Maße. Dass dies so spät geschieht, verwundert – schließlich gehören mehr als 80 % der Weltbevölkerung einer Religion an.
„Religionsgemeinschaften und glaubensbasierte Organisationen sind in einer einzigartigen Position, um Menschen, die von Konflikten und Katastrophen betroffen sind, spirituelle Hilfe zu leisten“, heißt es in der Charta für glaubensgestützte humanitäre Maßnahmen (Charter for Faith-Based Humanitarian Action). Sie wurde 2016 auf dem World Humanitarian Summit in Istanbul verabschiedet und bedeutete einen Paradigmenwechsel in der Entwicklungszusammenarbeit des Globalen Nordens. Bis in die 2000er-Jahre hinein dominierte ein säkularer Ansatz: Religion galt als private Angelegenheit, und entwicklungspolitisches Handeln sollte neutral, rational und wissenschaftlich fundiert sein. Es bestand die Angst, glaubensgestützte Akteure könnten missionarische und konfessionelle Interessen in die Zusammenarbeit einbringen.
Auch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) erkannte 2016 in einem Papier an, dass Religion eine wichtige Quelle für Werte sei und Orientierung im Hinblick auf ethische und rechtliche Normen biete. Sie könne die Widerstandsfähigkeit Einzelner und ganzer Gesellschaften stärken, weil sie Erklärungen und Rituale biete, die den Menschen helfen, mit Verlust, Leid, Versagen und Katastrophen umzugehen, so das BMZ. Lokale religiöse Akteure haben seitdem in Programmen internationaler Hilfsorganisationen an Bedeutung gewonnen. Ihre lokalen Kapazitäten und Perspektiven fließen in die Programmplanung ein.
Dass viele Menschen Spiritualität und Glaube einen hohen Stellenwert in ihrem persönlichen Leben einräumen, ist nur eine von mehreren Dimensionen, die es im Entwicklungskontext zu berücksichtigen gilt. Eine weitere wichtige Dimension ist die Bedeutung lokaler Religionsgemeinschaften und die Rolle religiöser Führungspersonen. Zudem darf auch die institutionelle Ebene nicht außer Acht bleiben, da Kirchen und glaubensgestützte Organisationen gegenüber säkularen Organisationen einige Besonderheiten aufweisen können, die die Ausgestaltung internationaler Entwicklungsprogramme (mit-)prägen.
Glaubensgestützte Organisationen bilden ein diverses Feld unterschiedlichster Organisationsformen und religiöser Zugehörigkeiten. Im Bereich der christlichen Kirchen zählen dazu international agierende Kirchenverbünde ebenso wie zivilgesellschaftliche Organisationen, die personell oder ideell mit einer Kirche in Verbindung stehen, bis hin zu kleinen lokalen Kirchengemeinden auf dem Land. Sie alle eröffnen für die internationale Entwicklungszusammenarbeit verschiedene Potenziale, wie ein Blick auf konkrete Beispiele zeigt.
Die Rolle von Kirchen in Infrastrukturschwachen Regionen
In einigen afrikanischen Ländern reicht das psychologische Angebot staatlicher und privater Träger bei Weitem nicht aus. Kirchliche Institutionen sind dann oft die erste Anlaufstelle seelsorgerischer Begleitung und genießen großes Vertrauen – wie zum Beispiel das Nkhoma Mission Hospital in der Nähe der malawischen Hauptstadt Lilongwe. Gemeinsam mit lokalen Kirchengemeinden will es in einem mehrjährigen Pilotprojekt mit der Bevölkerung ins Gespräch kommen über psychische Krankheiten und das gesellschaftlich sensible Thema Suizid. Die Mitarbeitenden nehmen Bezug auf religiöse Spiritualität und traditionelle Werte, um Suizid zu entstigmatisieren und den Menschen dabei zu helfen, ihn nicht mehr als spirituellen Mangel zu verstehen.
Zusammen mit seinem langjährigen Partner, dem Deutschen Institut für Ärztliche Mission e. V. (Difäm), bildet das Hospital Pastor*innen aus, um das Wissen zu psychischen Krankheiten und zum Thema Suizid in die Gemeinden zu tragen. Das langfristige Ziel ist ein grundlegender Bewusstseinswandel: Psychotherapie soll künftig als Stärke verstanden werden, und Bedürftige sollen in die Lage versetzt werden, Hilfe zu suchen.
Zahlreiche Staaten schränken zivilgesellschaftliche Arbeit zunehmend ein, um kritische Stimmen verstummen zu lassen. Kirchen und glaubensgestützten Organisationen bleiben diese schwindenden Räume oft länger eröffnet als manch säkularen Organisationen. Beispiele dafür gibt es auch in Europa, ob unter dem diktatorischen Regime in Belarus oder in der Arbeit mit Geflüchteten in Griechenland, Ungarn oder Polen. Von Gesetzgebungen, die Organisationen extra besteuern oder kostspielige Registrierungen vorsehen, sind kirchliche Träger zunächst oft ausgenommen. Versiegen staatliche Zuschüsse, verfügen Kirchen und glaubensbasierte Organisationen noch über kirchliche Mittel wie Kollekten, um arbeiten und sich unabhängig kritisch äußern zu können.
Ein Beispiel ist hier die Kritik an der zunehmend restriktiven europäischen Asylpolitik. Kirchen und ihre Organisationen wie die Naomi-Werkstatt für Flüchtlinge in Griechenland, der AIDRom-Dachverband der Kirchen in Rumänien oder der Polnische Ökumenische Rat schafften es immer wieder, sich als progressive Stimmen öffentlich Gehör zu verschaffen. Theologisch begründet fordern sie glaubwürdig das „Willkommenheißen der Fremden“ ein. Sie machten dabei immer wieder auf die schlechte psychische Verfassung von Geflüchteten aufmerksam und auch auf deren besondere Belastung durch immer gefährlichere Fluchtrouten sowie die Aufnahmebedingungen in den Zielländern.
Stabilisierung von Gemeinschaften im Alltag
Die psychosoziale Arbeit der Kirchen ist nicht auf die therapeutische Begleitung einer Person durch psychologisches Fachpersonal beschränkt. Gemeinschaft und ein strukturierter, stabiler Alltag sind ebenfalls wichtig. In diesem Sinne erhalten Betroffene auch Hilfe bei der Suche nach einer Wohnung, einem funktionierenden Umfeld, nachbarschaftlichen Beziehungen oder einem ökonomischen Auskommen.
Einen sehr hohen Bedarf gibt es dafür im Kontext des Nahostkonflikts mit seinen hohen Verlusten, Fluchtbewegungen und Diskriminierung. Die Young Men’s Christian Association (YMCA) in Ostjerusalem hilft kriegsversehrten palästinensischen Jugendlichen mit körperlichen Beeinträchtigungen, indem sie ihnen eine Kombination aus therapeutischem Gespräch und beruflicher Ausbildung anbietet. Das Angebot verbindet somit die Hoffnung auf ein besseres Leben mit einem Gefühl von Sicherheit.
Steigender Druck durch Standardisierung und Effizienzansprüche
Im globalen Entwicklungskontext bieten Kirchen und glaubensgestützte Organisationen aus spiritueller und institutioneller Perspektive also ein hohes Potenzial: Sie füllen Leerstellen, wo staatliche oder private Dienstleistungsangebote fehlen; sie sind sowohl in der Behandlung psychischer Belastungen und Erkrankungen als auch in ihrer Prävention auf verschiedensten Ebenen sehr aktiv; und sie haben oft eine wichtige politische Stimme. In der therapeutischen und psychosozialen Arbeit stehen sie aber unter zunehmendem Druck, ähnlich wie säkulare Organisationen. Standardisierte Ansätze und Effizienzdenken funktionieren nicht überall gleichermaßen. Zwar können die Organisationen durch spirituelle Ansätze gewisse Alternativen und Freiräume bieten, doch Fördervoraussetzungen internationaler Geber, Wirkungslogik und Zielerfüllungsindikatoren setzen diesen Freiräumen technische Grenzen.
Wir von Brot für die Welt, dem protestantischen Entwicklungsdienst, bieten Projektverantwortlichen in unserem Berliner Büro Orientierung für ein besseres Verständnis der Projektbegleitung in den Regionen an: Die 2024 erstellte Handreichung „Psychosoziale Perspektiven und Traumasensibilität“ soll ihnen helfen, psychosoziale Aspekte ihrer Arbeit genauer wahrzunehmen und dadurch angemessener bearbeiten zu können. Ziel ist Projektarbeit mit einem traumasensiblen Blick: Werden Menschen dabei unterstützt, sich optimal zu regenerieren und Traumata zu bewältigen? Ermöglichen wir ihnen Sicherheit und Kontrolle? Fördern wir ihr Empowerment und ihre Selbstfürsorge? Wie können wir psychosoziale Dimensionen im Projektzyklus berücksichtigen, von der Antragstellung über die Budgetplanung bis hin zu Projektbesuchen und Evaluierung? Und wie lässt sich in den Projekten dem potenziellen Machtgefälle begegnen, zwischen denen, die Hilfe geben, und denen, die sie empfangen?
Die Beantwortung dieser Fragen hilft uns, Menschen mit psychischen Problemen noch besser unterstützen zu können und die Förderung psychischer Gesundheit als einen integralen Bestandteil in der internationalen Programmarbeit zu etablieren.
Sabine Schwirner arbeitet bei Brot für die Welt und ist Mitglied der Fachgruppe Psychosoziale Arbeit und mentale Gesundheit.
sabine.schwirner@brot-fuer-die-welt.de