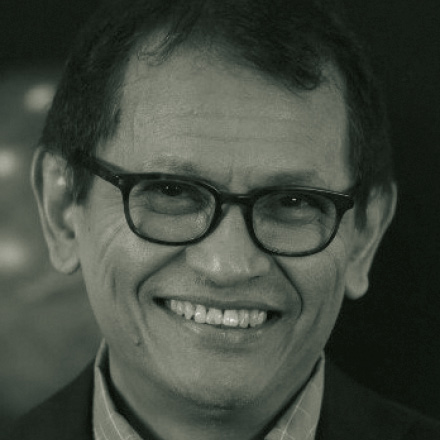Historische Wurzeln
Besserwisser mit besten Absichten
[ Von Philipp Lepenies ]
Seit es Entwicklungszusammenarbeit gibt, steht sie auch in der Kritik. Dabei wird weniger die Hilfe als solche in Frage gestellt, sondern ihre Form – vor allem die Art der Wissensvermittlung durch externe Experten. Der Experte, der glaubt, alle Antworten parat zu haben, und wenig Rücksicht auf die Sichtweisen der Partner nimmt, gilt als ein Haupthindernis für erfolgreiche Entwicklung.
Schon im Standardwerk „The Strategy of Economic Development“ von 1958 nannte der Ökonom Albert Hirschman das „Visiting Economist Syndrome“ als einen Grund für ausbleibenden Erfolg. Er beschrieb es als „die Tendenz der externen Berater und Experten, fertige Konzepte, Maßnahmen und Strategien zu verschreiben – trotz eines nur minimalen Kontaktes mit dem ‚Patienten‘“. In späteren Schriften wie „Journeys towards Progress“ von 1963 erkannte Hirschman einen grundsätzlichen „Überoptimismus“ hinsichtlich der Lösbarkeit aller Entwicklungsprobleme.
Auch Ethnologen kritisierten die Neigung von Entwicklungshelfern, mit fertigen Konzepten in die Partnerländer einzufliegen und die Perspektive der Einheimischen zu ignorieren. Robert Chambers vom Institute for Development Studies in Sussex argumentierte bereits in den frühen 1980er Jahren, die Experten könnten sich aufgrund ihrer feststehenden Meinungen gar kein präzises Bild über die Lage in den Entwicklungsländern machen. Und Richard Rottenburg stellte fest: In der Entwicklungszusammenarbeit gehe es immer noch um einen Modelltransfer von den Reichen zu den Armen, der durch die Rhetorik von Zusammenarbeit und Dialog nur kaschiert werde und zu Missverständnissen und Misserfolgen führe.
Viel Aufmerksamkeit erfuhr der Ökonom William Easterly mit seinem Buch „The White Man’s Burden“ (auf Deutsch: „Wir retten die Welt zu Tode“) von 2006. Darin kritisiert er vor allem die vermeintlich allwissenden „Planer“, die mit Hirschmans „Visiting Economists“ weitgehend identisch sind.
Die Entwicklungshelfer fassten Kritik an ihrer Arbeitsweise oft als ein verzerrtes Abbild, als eine Karikatur auf. Wirklich ernst nahmen sie diese nicht. Eine Auseinandersetzung mit den Kritikern wird dadurch erschwert, dass Entwicklungshelfer sich längst auf Partnerschaft und Kooperation statt Paternalismus eingestellt haben und sich auch darum bemühen – zumindest rhetorisch. Sie erkennen sich also in der Kritik oft nicht wieder. Dass diese aber über so lange Zeit immer wieder vorgebracht wird, deutet darauf hin, dass etwas nicht stimmt. Es scheint einen Verhaltensautomatismus in der Entwicklungszusammenarbeit zu geben, der dazu führt, dass die Helfer den Eindruck vermitteln, schon alle Lösungen parat zu haben.
Im Grunde ist Entwicklungszusammenarbeit eine Form von institutionalisierter Besserwisserei. Das ist nicht abwertend gemeint. Entwicklungsinstitutionen glauben in der Tat besser zu wissen, wie Probleme zu lösen sind. Das ist nicht verwunderlich. Die Institutionen haben über die Jahre einen unglaublichen Wissensschatz angehäuft, von dem andere profitieren können und sollen. Doch die Praxis der Wissensvermittlung ist nicht unproblematisch.
Linearer Pfad des Fortschritts
Entwicklungszusammenarbeit ist seit ihren Anfängen weniger Kapitalhilfe als Wissenstransfer. Schon der US-amerikanische Präsident Harry S. Truman erklärte in seiner Antrittsrede 1949, die als Geburtsstunde der Entwicklungszusammenarbeit gilt, dass die Industriestaaten das nötige Wissen zur Beendigung der Armut auf der Welt besäßen und allen zur Verfügung stellen müssten.
Auch die Weltbank sprach vor einigen Jahren von der Notwendigkeit, die „knowledge gaps“ zwischen reichen Ländern und Schwellen- und Entwicklungsländern zu schließen, und positionierte sich als „knowledge bank“, die das Weltwissen über Entwicklung bündelt und verwaltet.
Die Idee des Wissenstransfers zwischen Ländern ist viel älter als die Entwicklungspolitik. Sie stammt aus der Fortschritts- und Zivilisationsphilosophie des späten 18. Jahrhunderts in Frankreich. Gemäß dieser Theorie befanden sich alle Gesellschaften auf einem linearen Pfad des Fortschritts. Jede Nation würde sich irgendwann genau wie alle anderen entwickeln. Die bestehenden Unterschiede zwischen Ländern waren allein qualitativ zu erklären. Es gab kein Miteinander, sondern nur ein Hintereinander. Vorne die Zivilisierten, dahinter die weniger Zivilisierten und Wilden.
Die Begriffe Zivilisation und Fortschritt wurden anfangs synonym benutzt. Die Idee des Fortschritts war ursprünglich auf Wissensfortschritt begrenzt. Der Begriff beschrieb ab dem 17. Jahrhundert, dass sich im Lauf der Geschichte wissenschaftliche Kenntnisse stetig vermehrten.
Die Idee vom Fortschritt als eine Zukunftsvision kam erst in der französischen Aufklärung auf. Marquis de Condorcet wagte 1793 als Erster in seinem „Entwurf einer historischen Darstellung der Fortschritte des menschlichen Geistes“ eine nicht-christliche Prophezeiung dessen, was die Menschheit in der Zukunft erwarten könne: eine Welt, in der es keine Ungleichheiten mehr zwischen den Staaten und innerhalb einzelner Gesellschaften geben würde.
Condorcets Schrift kann auch als Vorwegnahme der Entwicklungszusammenarbeit verstanden werden. Er beschrieb nicht nur die Unterschiede des in seinen Augen schon weit fortgeschrittenen Frankreichs zu Staaten in Asien und Afrika. Er prophezeite auch: „Es kommt ohne Zweifel der Moment, in dem wir [die Zivilisierten] für sie [die weniger Zivilisierten] zu nützlichen Instrumenten oder zu großzügigen Befreiern werden.“ Analog zu christlichen Missionaren sollten von nun an Männer in ferne Länder fahren, um den Menschen dort wissenschaftliche Kenntnisse zu vermitteln – „die Wahrheit“, wie Condorcet es nannte.
Die Thesen Condorcets waren Ausdruck des Universalismusgedankens, der sich zu Zeiten der Französischen Revolution ausbreitete. Die Errungenschaften des Fortschritts – das schloss seit der Verabschiedung einer universellen Erklärung der Menschenrechte in der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten und durch die französische Nationalversammlung auch den politischen Fortschritt mit ein – sollten allen Menschen auf der Welt zu Gute kommen. In weniger entwickelten Ländern sollte der Fortschritt aktiv beschleunigt werden: durch Wissensvermittlung. Die Fortgeschritteneren nahmen an, dass sie ihre Position ihrem größeren Know-how verdankten. Der Wissenstransfer war einseitig. Ein Lernen von den anderen war nicht vorgesehen.
Die Entwicklungszusammenarbeit ist ein Nachkomme dieser um die Wende zum 19. Jahrhundert formulierten Ideen. Diese Mentalität bestimmt unbewusst die Handlungen der Helfer und weckt auch Erwartungen bei den Menschen in den Entwicklungsländern. Sie erhoffen sich Vorschläge und Expertenwissen. Das muss nicht zwangsläufig zu Misserfolgen führen. Jedoch setzt sich dadurch der Verhaltensautomatismus bei den Experten fort.
Prozess beidseitigen Lernens
Die Verbesserungsvorschläge der Kritiker der Entwicklungszusammenarbeit lassen sich schnell zusammenfassen: Entwicklungszusammenarbeit müsse ein ergebnisoffener Prozess des gemeinsamen Lernens sein, eines beidseitigen Lernens statt eines einseitigen Wissenstransfers. Entwicklungshelfer sollten flexibel sein und nicht nur starr ihre eigenen Modelle durchsetzen wollen.
Erstaunlich ist, dass die Verbesserungsvorschläge sehr einfach und banal klingen. Aber auch wenn Experten sicher nicht wie unsensible Automaten handeln und selbst den Anspruch haben, mit Taktgefühl und relevanter Ortskenntnis vorzugehen, scheinen die Vorschläge schwierig umzusetzen zu sein, das beweist die anhaltende Kritik.
Der Ökonom John Maynard Keynes schrieb, Politiker seien sich häufig nicht bewusst, wie sehr sie den Ideen verstorbener Ökonomen verpflichtet seien. Für die Entwicklungspolitik lässt sich formulieren: Die Helfer von heute sind sich häufig nicht darüber im Klaren, wie sehr ihre Arbeit durch die Ideen französischer Philosophen der Aufklärung geprägt ist.
Eine klare Veränderung und Verbesserung von Verhaltensautomatismen wird leichter möglich, wenn sich die Entwicklungshelfer ihr historisches Erbe klarmachen und verstehen, warum sie so arbeiten, wie sie es tun. Die Kenntnis der Geschichte des eigenen Metiers ist der vielleicht wichtigste Schritt für eine Veränderung im eigenen Handeln. Erfolge auf dem Weg zu diesem Wandel dürften sich daran ablesen lassen, ob die wiederkehrende Kritik an der Art der Wissensvermittlung allmählich verstummt.