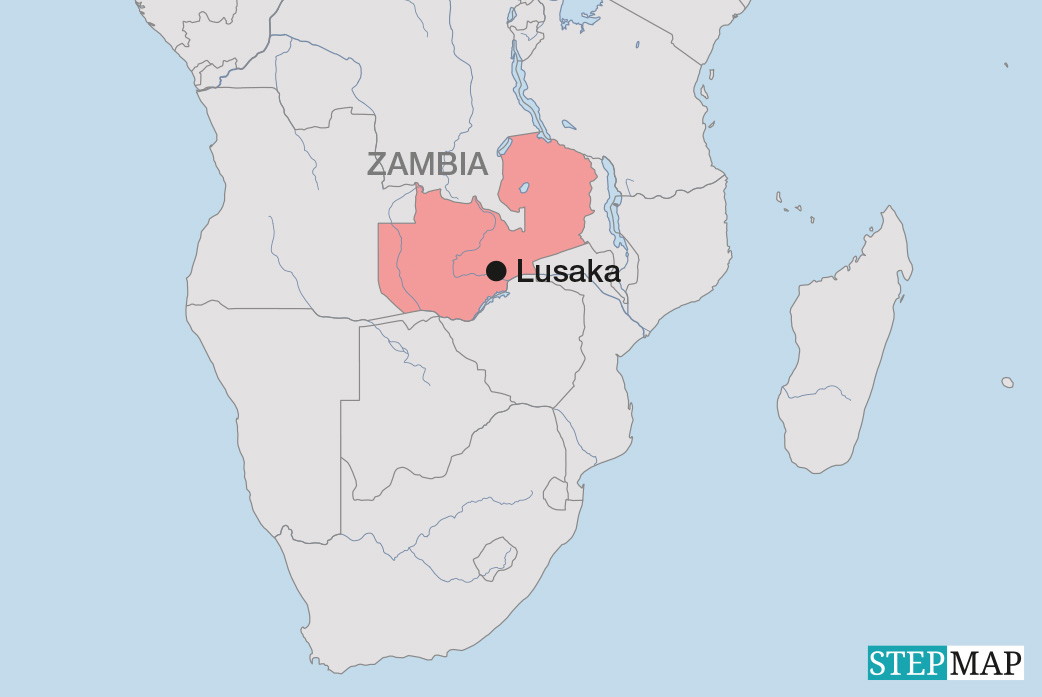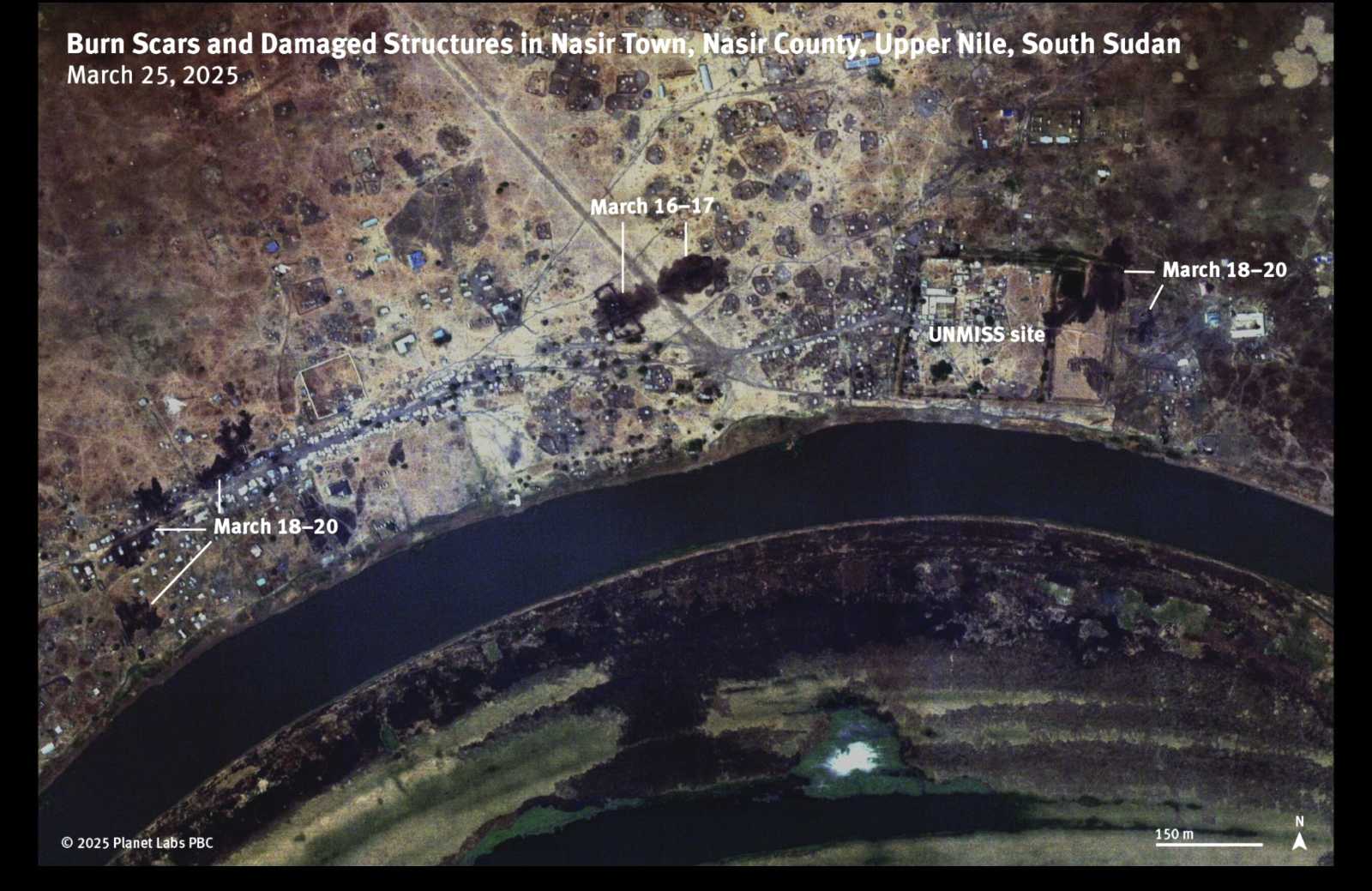Einfache Lösungen
Mit der Infrastruktur und der Wohlstandsentwicklung ist es so ähnlich wie mit der Henne und dem Ei. Was zuerst da war, lässt sich nicht feststellen. Das eine bedingt das andere.
Wer gelegentlich Städte verschiedener Weltregionen aus dem Flugzeug betrachtet, weiß, wie sehr Straßen, Kanäle, Eisenbahnen und dergleichen reiche Regionen prägen. Wer zum Beispiel Frankfurt anfliegt, sieht von oben mehrspurige Autobahnen in alle Himmelsrichtungen und ICE-Trassen, die nach Stuttgart, Köln, Berlin und München führen. Den Main regulieren Staustufen, die auch der Stromerzeugung dienen. Aber das, was Besucher aus Asien oder Afrika auf ihrer ersten Deutschlandreise für periphere Slumsiedlungen halten, sind Freizeitanlagen: gut gedüngte, aber unbewohnte Schrebergärten.
Ein besonderes Zeichen des Wohlstands ist auch, dass wichtige Komponenten der Frankfurter Infrastruktur von oben nicht zu sehen sind. Abwasserrohre, Strom- und Telefonfestnetz verlaufen unterirdisch, und in der Innenstadt gilt das auch für die wichtigsten Nahverkehrsbahnen.
Metropolen der Dritten Welt sehen ganz anders aus. Typischerweise führt dort eine große Straße vom Flughafen ins Zentrum, ansonsten gibt es am Stadtrand Feldwege sowie ein kleine Zahl zweispuriger Landstraßen. Busse stecken im Stau, und Eisenbahnen haben oft nur einen Schienenstrang, der als Erbe der Kolonialgeschichte das rohstoffreiche Hinterland an einen Seehafen anbindet. Abwasser steht in offenen Kanälen, und in der Regenzeit werden auch manche Wohnstraßen zu Schlammpisten.
Der Kontrast ist so deutlich, dass die Fachwelt lange glaubte, Infrastruktur sei der Schlüssel zum volkswirtschaftlichen Fortschritt. In den Anfängen der Entwicklungspolitik wurden Straßen, Brücken und Kraftwerke gebaut, Brunnen gebohrt und Staudämme errichtet. Leider blieben die Ergebnisse oft mager, denn die ehrgeizigen Projekte waren aufgepfropft und verfielen schnell. Daraus wurden Lehren gezogen. Die bekannte Neigung der Weltbank zu privatwirtschaftlichen Lösungen gehört zu den Konsequenzen. Zu deren plausiblen Argumenten gehört, dass Wettbewerber in der Regel effizienter wirtschaften als staatliche Monopolbetriebe und dass Nutzergebühren dazu beitragen, dass die versorgte Bevölkerung die vorhandene Infrastruktur wertschätzt und ein Gefühl von Ownership entwickelt.
Doch Privatsektorgläubigkeit führt ebenfalls in die Irre. Sie beachtet nicht, dass manche Menschen schlicht nicht über die nötig Kaufkraft verfügen, um als Kunden aufzutreten. Vor allem aber übersieht sie, dass Infrastrukturen häufig auf natürlichen Monopolen beruhen: Netzen aus Schienen, Leitungen oder auch Straßen. Private Eigentümer solcher Netze haben ökonomische Partikularinteressen – und setzen sie durch, wenn sie können. Deshalb ist kluge Regulierung wichtig; und so spielen denn auch in vielen Industrienationen staatliche Stellen weiterhin zentrale Rollen in der Bereitstellung von Infrastruktur.
Gleichwohl ist Politikern zur Bescheidenheit zu raten. Infrastrukturen müssen in die Gesellschaft passen, der sie dienen sollen. Die Dimensionen müssen stimmen. Prestigeprojekte bringen im Kampf gegen die Armut wenig, wohingegen kleine, unspektakuläre, aber zuverlässige Infrastrukturen tatsächlich helfen. Wo Hochspannungsleitungen über Land unerschwinglich teuer wären, ist etwa dezentrale Stromversorgung die Lösung – und nicht eine zweitbeste Alternative. Das richtige Maß zu finden ist vermutlich die wichtigste Aufgabe überhaupt.