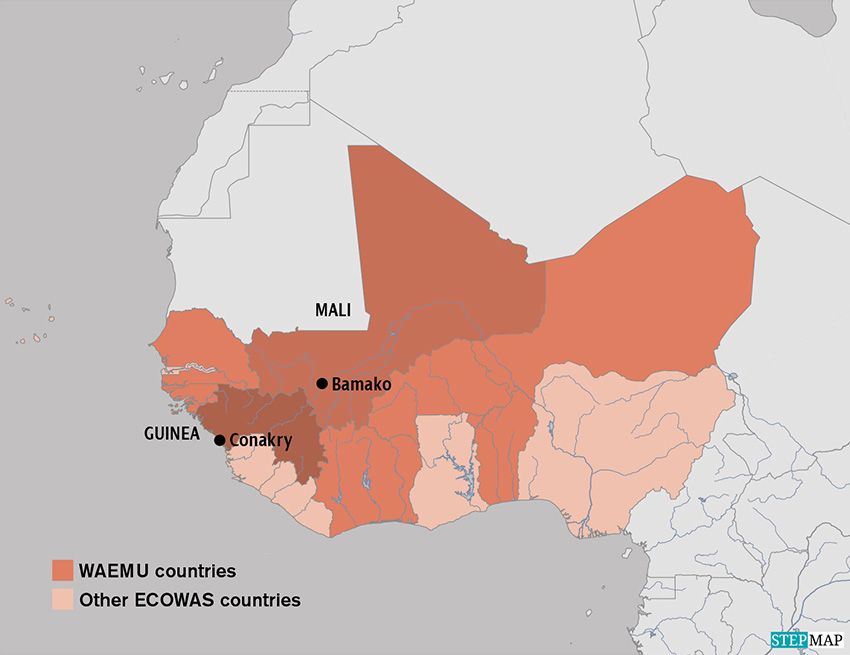Demokratieförderung
Blutige Bürgernähe
Seit dem Jahr 2000 starben im Umfeld politischer Wahlen mindestens 10 000 Menschen. Fast jede vierte Wahl auf der Welt ist derzeit von Mord und Totschlag überschattet. Lebensgefährlich ist die Demokratie aber weniger in wohlhabenden Industrieländern – sondern besonders häufig in schwachen Staaten, wo autoritäre Regimes zu überwinden sind. Gewalt erschüttert Hoffnungen dortiger Bürger auf Freiheit und Selbstbestimmung. Umso brennender ist die Frage, ob die Demokratieförderung dieses Phänomen eindämmen kann.
„Ohne Wohlstand kann keine Demokratie überleben“, behauptete Frankreichs früherer Staatspräsident François Mitterand. Wissenschaftler bestätigen: Wenn die ökonomischen Grundlagen für politische Stabilität fehlen, erhöhen Wahlen das Risiko von Gewaltausbrüchen. Als Schwellenwert nannte der Ökonom Paul Collier in seinem Buch „Wars, Guns and Vote“ (2009) ein Pro-Kopf-Einkommen von rund 2700 Dollar. In ärmeren Ländern, schreibt der Leiter des Zentrums für Afrikanische Wirtschaft an der Universität Oxford, mache Demokratie die Gesellschaft gefährlicher.
Gewalt während Wahlen bedeutet, dass Regierungen weder legitim noch im Sinne des Gesetzes effektiv handeln können. Deshalb seien ihre Ursachen gründlich zu bedenken, empfiehlt Lars Brozus von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) all denen, die Demokratie in fremden Ländern fördern wollen. Den Kampf um Macht umschreibt der Autor einer Studie mit Begriffen der Marktwirtschaft: Macht sei ein knappes Gut, das hohe Nachfrage auslöst.
Brozus fordert höhere „Legitimitätsdividenden“ für gewaltfreie Wahlen, deren Ergebnis die Gesellschaft möglichst breit widerspiegeln. Die Behörden, welche das Plebiszit organisieren, müssten unabhängig sein; auch die politische Opposition verdiene aber Wertschätzung. Die Wahlverlierer bräuchten wenigstens Teilhabe in Form von Anerkennung. Demokratieförderung sollte laut SWP-Studie deshalb drei strategischen Aufgaben folgen und:
– Macht wirksam aufteilen,
– deren Kontrolle institutionalisieren und
– Minderheiten schützen.
Die Zahl demokratisch regierter Staaten hat sich in 20 Jahren weltweit fast verdoppelt: 92 von heute 192 UN-Mitgliedern sind Demokratien. Mehr Wahlen in armen Ländern bedeuten aber auch mehr Anlässe für wahlbezogene Gewalt. Dass die Demokratieförderung internationaler Geber fragmentiert sei, meint die SWP, mache die Dinge nicht leichter.
Eigene Akzente setzen
Deutschland sollte, so die Studie, unter übrigen Akteuren für Demokratisierung (EU, USA, OSZE, Weltbank, OECD, nichtstaatliche Gruppen, Stiftungen) seine Stärken gezielter einbringen, findet Lars Brozus. Hohe Wertschätzung genießen laut seiner Studie Einrichtungen wie die parteinahen politischen Stiftungen und die Bertelsmann-Stiftung (siehe auch Essay über die European Endowment for Democracy, S. 82 f.). Sie erlauben gezielte Hilfe beim Aufbau „weicher Faktoren“ wie Parteien und Gewerkschaften sowie eines öffentlich-rechtlichen Medienwesens.
Gerade in schwachen Staaten, wo Unsicherheit und Armut herrschen, erschöpft sich Demokratie nicht in Landeswahlen des Präsidenten, sondern lebt vom lokalen Beispiel: Runde Tische, Ältestenräte oder Jirgas können gewohnten Entscheidungsträgern den Weg ebnen vom klassischen Konsens zu demokratischem Wettbewerb, heißt es in der SWP-Studie. Gleichzeitig sollte sich die internationale Gemeinschaft verpflichten, für ihre Berichterstattung über wahlbezogene Gewalt weltweite Standards festzulegen.
Peter Hauff