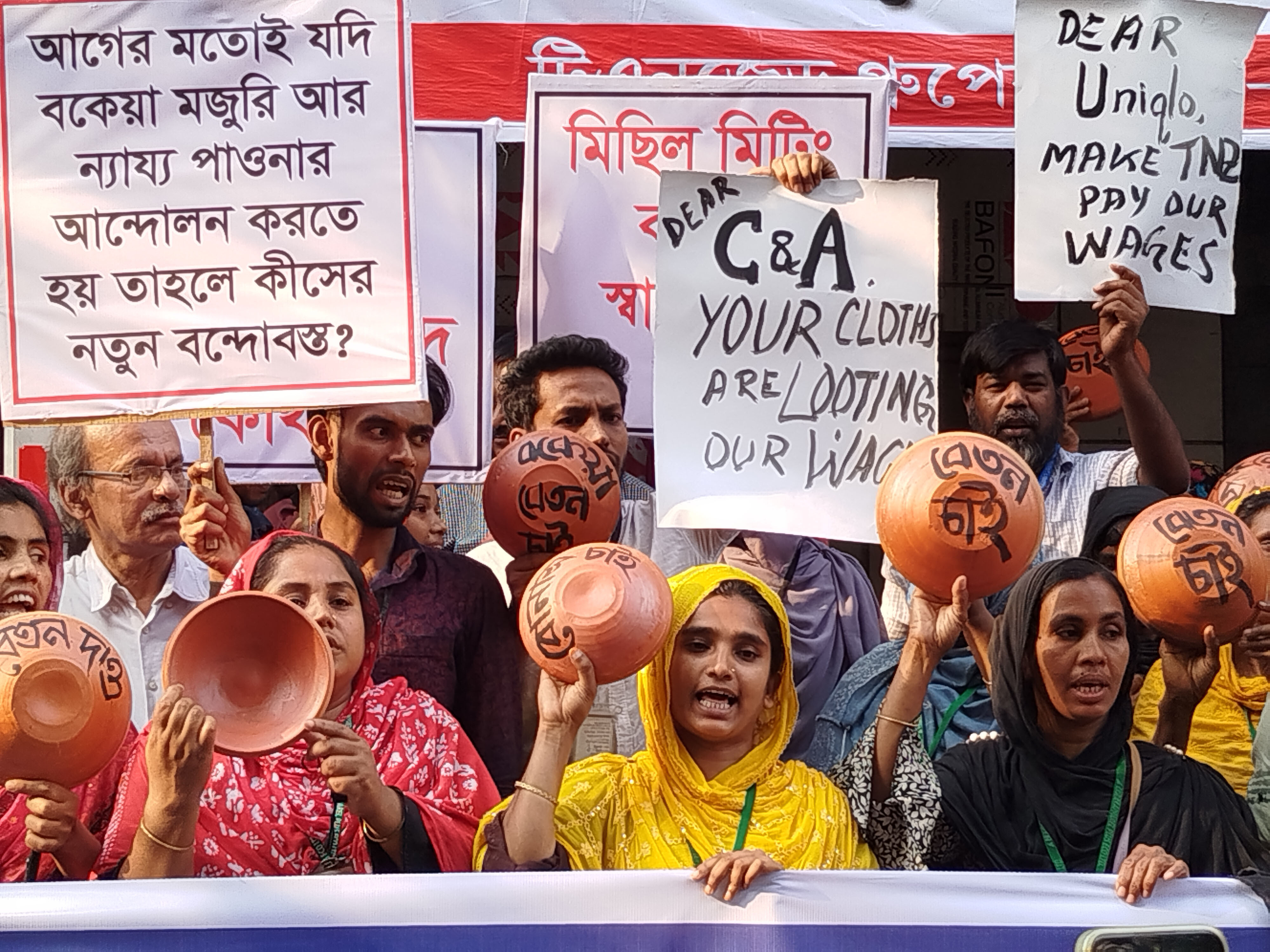Weltwirtschaft
Faire Regeln
Von Uwe Jens
Deutsche Politiker berufen sich gern auf die soziale Marktwirtschaft. Der Begriff ist allerdings schwammig. Geprägt wurde er ursprünglich von dem liberalen Wirtschaftswissenschaftler Walter Eucken. Seine Grundidee war, dass der Markt einen Ordnungsrahmen braucht, der beispielsweise mit stringentem Kartellrecht den Wettbewerb sichert, damit keine Monopole entstehen, die zu ungerechtfertigten Profiten und Macht führen. Im Alltagsverständnis vieler Deutscher gehören zur sozialen Marktwirtschaft darüber hinaus die Sozialversicherungen, die schon Bismarck im deutschen Reich einführte, um die Lebensrisiken Alter, Krankheit und Arbeitslosigkeit aufzufangen.
Die Realität der Bundesrepublik entspricht diesen relativ einfachen Prinzipien heute nicht mehr, und das Leitbild der sozialen Marktwirtschaft bietet deshalb auch keine klare Orientierung mehr. Politiker – vor allem aus den Regierungsparteien – begreifen bis heute nicht, dass die weltweite Liberalisierungswelle in den 80er Jahren zu weit führte. Das gilt besonders für das Finanz- und Kreditwesen. Deshalb löste der Kollaps der Investment-Bank Lehman Brothers vor vier Jahren einen globalen Schock aus, von dem sich die Weltwirtschaft bis heute nicht erholt hat.
Die Politik ist zur Beute der Finanzwirtschaft geworden. Regierungen mussten Billionensummen aufwenden, um eine globale Depression abzuwenden, kränkelnde Industriezweige zu stützen und angeschlagene Finanzinstitute zu retten. Auch die Krise, die heute die Europäische Währungsunion bedroht, geht auf den Schock von 2008 zurück. Denn Staaten wie Spanien oder Irland mussten sich hoch verschulden, um rettend einspringen zu können.
In der aktuellen schwierigen Lage brauchen die Politiker Orientierung. Sie müssten jetzt klar öffentliche Interessen formulieren und auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse entscheiden, was zu tun ist. Stattdessen machen sie sich aber wie schon vor der Krise von der Finanzwirtschaft abhängig und schielen ängstlich auf Ratings und Zinssätze für Staatsanleihen. Klar ist aber: Wenn Spekulationsblasen Finanzkrisen mit potenziell katastrophalen Folgen auslösen, hat nicht einfach der Markt versagt. Solche Ereignisse bedeuten immer auch Staats- und Politikversagen.
Sozialismus am Ende, Kapitalismus deformiert
Wer die weltwirtschaftliche Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg betrachtet und einigermaßen realistisch ist, wird zunächst feststellen, dass die Vision eines reinen Sozialismus gescheitert ist. Nur noch in zwei Ländern der Welt werden klassische sozialistische Dogmen ernsthaft propagiert. Kuba und Nordkorea sind aber ganz offensichtlich nicht Vorreiter der Moderne, sondern Schlusslichter einer gescheiterten Ideologie.
Dennoch sind linke Stimmen, die den Kapitalismus kritisieren, ihrerseits wohl begründet. Auch um ihn ist es nicht allzu gut bestellt. In mehreren seiner Formen ist er entartet. Die drei wichtigsten aktuellen Missbildungen sind:
– der oligarchische Kapitalismus, wie er in Russland anzutreffen ist und sich zurzeit in der EU herausbildet: eine technokratische Machtballung von Bürokratie und Großunternehmen, auf die Wähler wenig Einfluss haben,
– ein autoritärer Staatskapitalismus, für den China das beste Beispiel liefert, und
– der Staats-Oligopol-Kapitalismus, eine Machtverflechtung zwischen Großwirtschaft und Politik, wie sie beispielsweise in Japan, Korea oder Frankreich anzutreffen ist.
Als positives Modell ließe sich vermutlich der „demokratische Kapitalismus“ hervorheben, der in Skandinavien üblich ist. Auf den Märkten herrscht dort weitgehend Freiheit, aber der Staat finanziert mit hohen Umsatzsteuern umfassende Sozial- und Bildungsprogramme, sodass er einigermaßen für Chancengleichheit sorgen kann. Das alte liberale Ideal der Chancengleichheit kommt bei marktradikalen Politikern seit Jahrzehnten zu kurz.
Eingefleischte Sozialisten fordern dagegen gern ein Primat der Politik gegenüber der Wirtschaft. Wir wissen aber, dass Kommandowirtschaft nicht funktioniert. Notwendig ist – da hatte Walter Eucken im Kern recht – ein klarer staatlicher Rahmen, in dem sich private Interessen unabhängig entfalten können. Dieser staatliche Rahmen muss die Märkte vor ihren eigenen Auswüchsen schützen. Er muss darüber hinaus aber auch für gesellschaftliche Inklusion sorgen und Menschen aus allen Schichten Aufstiegschancen bieten.
Langfristiges Ziel der Politik müssen faire Bedingungen sein. Wir brauchen ein „level playing field“, auf dem alle Mitspieler grundsätzlich dieselben Ausgangsbedingungen haben und sich an dieselben Regeln halten müssen. Die besondere Herausforderung ist, dass wir das angesichts der Globalisierung heute weltweit brauchen. Kein Nationalstaat kann der Ökonomie noch den nötigen Rahmen geben. Gefordert sind nun vor allem die hochentwickelten Industrieländer. Sie können Fair Play nur von schwächeren und aufstrebenden Partnern erwarten, wenn sie selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Das ist aber oft nicht der Fall.
Gefährliche Geldpolitik
Die Spitzenpolitiker der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer treffen sich seit 2008 regelmäßig im Rahmen der G20, unter anderem, um die global tätige Finanzwirtschaft besser zu regulieren. Auf diesem Feld haben sie aber bisher noch kaum etwas erreicht. Derweil haben die Notenbanken Federal Reserve in den USA und die Europäische Zentralbank (EZB) ein ziemlich unfaires Spiel begonnen, indem sie privaten Geldhäusern aus ihren Ländern praktisch zinsfrei jeweils mehr als eine Billion Euro zur Verfügung gestellt haben. Dieses billige Geld sucht jetzt auch Anlagemöglichkeiten in den aufstrebenden Schwellenländern, in denen hohe Renditen und hohe Zinsen zu erwarten sind.
Das heiße Geld fließt schnell herein, aber genauso schnell wieder hinaus. Kapitalanleger aus reichen Ländern profitieren so vom Aufschwung in den Schwellenländern. Sie bringen dort aber auch die Märkte durcheinander und destabilisieren sie. Nur Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff hat gegen diese Politik deutlich das Wort ergriffen. Sie versteht auch den noch bedenklicheren zweiten Effekt der lockeren Geldpolitik, die relative Abwertung von Dollar und Euro gegenüber anderen Währungen. Dadurch werden Exporte aus den USA und der EU billiger und Importe dorthin teurer.
Das kennen wir aus 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Damals versuchten alle Staaten, sich durch Abwertung Vorteile im internationalen Wettbewerb zu verschaffen, und weil das alle taten, hatte niemand etwas davon. Der Teufelskreis verschärfte nur die Weltwirtschaftskrise. Es wäre gut, wenn heute der Internationale Währungsfonds (IWF) durch Koordination und einheitliche Regeln für eine faire Geldpolitik aller großen Zentralbanken sorgte.
Die Welthandelsorganisation (WTO) ist nach anfänglichen Erfolgen auf eine schiefe Bahn geraten. Die Verhandlungsrunde, die seit 2001 die Weltmarktchancen der Entwicklungsländer verbessern soll, kommt nicht voran – vor allem, weil EU und USA kaum zu Kompromissen bereit sind. Sie weigern sich beispielsweise hartnäckig, Subventionen für die Baumwoll- und Zuckerproduktion einzustellen. Dabei ist volkswirtschaftlich längst klar, dass Handelsverzerrungen im Agrarbereich, in dem ärmere Länder mit niedrigen Lohnkosten grundsätzlich Wettbewerbsvorteile haben, der Schaffung eines fairen Spielfelds im Wege stehen.
Politiker aus Europa und Nordamerika werfen China gern Dumping vor. Diese Klage ist leicht erhoben, aber längst nicht immer gerechtfertigt. Dumping bedeutet nicht, dass ein Unternehmen eine Ware im Ausland billiger anbietet als daheim, sondern dass es Preise verlangt, die seine eigenen Produktionskosten nicht decken. EU-Experten beanstanden derzeit, China subventioniere mit günstigen Staatskrediten die Herstellung von Solarpaneelen. Diese Dumpingvorwürfe verschweigen aber, dass Europas lockere Geldpolitik ihrerseits zu sehr niedrigen Zinsen führt.
Unfair ist auch die Unterstützung von Global Playern, Konzernriesen mit Weltgeltung. Sie stammen meist aus Industrieländern. Durch die Privatisierung der Deutschen Bundespost entstanden in den 90er Jahren beispielsweise die Aktiengesellschaften Deutsche Post und Deutsche Telekom, die zu erheblichen Anteilen immer noch dem Staat gehören. Sie wurden anfangs mit Subventionen und Steuererleichterungen unterstützt und zu weltweiten Anbietern ausgebaut. Die binnenwirtschaftliche Privatisierung der Post ging also einher mit dem gezielten Aufbau eines „national champion“ mit starker Stellung gegenüber der internationalen Konkurrenz. Fairer Wettbewerb sieht anders aus.
Die Weltwirtschaft braucht einen gerechten Ordnungsrahmen, wenn nicht einfach das Recht des Stärkeren gelten soll. Die reiche Welt muss mit gutem Beispiel vorangehen. Ihre Regierungen scheinen gar nicht zu merken, dass sie ständig weiter Vertrauen verspielen.