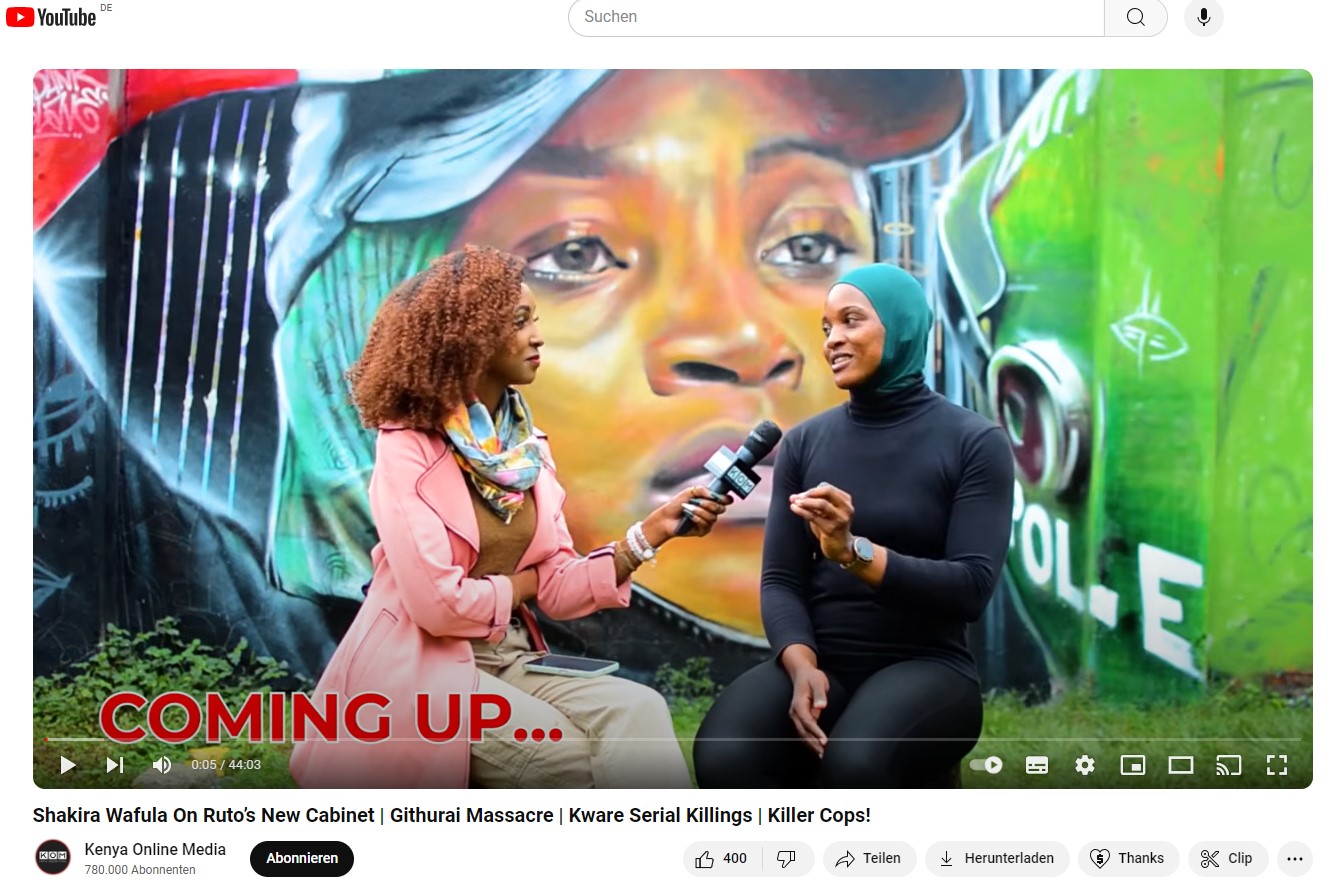Einwanderung
„Wir brauchen keine Retter, sondern Dialog auf Augenhöhe“

Deutschland ist seit Langem ein Einwanderungsland, hat sich aber lange schwergetan damit, sich als solches zu begreifen. Woran liegt das?
Wir hatten nie eine Kultur der Einwanderung. Meine Eltern kamen in den 1970er-Jahren aus der Türkei als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland. Sie wurden entsprechend auch als „Gäste“ behandelt, nicht als Bürger*innen. Das hat bei Migrant*innen großen Schmerz verursacht, und viel Potenzial blieb liegen. Es ist auch kein Zufall, dass meine Generation, die in Deutschland zur Welt gekommen ist, sich die Vorbilder in der antirassistischen Bürgerrechtsbewegung der USA gesucht hat, weil wir hier keine hatten.
Sie sind den 1980er-Jahren in Hannover als eines von elf Geschwistern in einer kurdisch-jesidischen Familie aufgewachsen, die aus der Türkei kam. Ihr Vater arbeitete als Fliesenleger. Wie blicken Sie im Hinblick auf die Zugehörigkeit zur Gesellschaft auf diese Zeit zurück?
Ich kann mich erinnern, dass mir und meiner Familie beim Aufwachsen das Gefühl vermittelt wurde: „Ihr könnt dankbar sein, dass wir euch gerettet haben.“ Bis zu einem Austausch auf Augenhöhe hat es sehr lange gedauert. Wir arbeiten heute noch daran. Meine jetzige Arbeit hat auch mit dem Schmerz von damals zu tun. Es ist eine sehr persönliche Angelegenheit, wenn du das Gefühl hast, immer darum kämpfen zu müssen, dazuzugehören.
Haben Sie ein konkretes Beispiel dafür?
Es fing schon damit an, dass meine Geschwister und ich lange nicht die deutsche Staatsbürgerschaft bekamen, obwohl wir hier geboren wurden. Mein Vater musste darum kämpfen. Ich wurde erst mit neun Jahren eingebürgert. Man muss sich bewusst machen, was das auch emotional bedeutet, wenn man Menschen, die ihre Wurzeln in anderen Ländern haben, das Gefühl gibt, dass sie nicht dazugehören oder nicht willkommen sind. Was allerdings geklappt hat, das war die Solidargemeinschaft. Sie war damals viel weiter als die Bundesregierung.
Bitte führen Sie das aus.
Es sprach zu Beginn viel gegen meine positive Entwicklung. Meine Mutter war Analphabetin und konnte kein Deutsch. Ich hatte keine Bücher zu Hause, es wurde nur Kurdisch gesprochen. Aber in unserem Stadtteil, Hannover Linden, hat man sich gegenseitig um sich gekümmert. Meine Geschwister und ich wurden früh in den Kindergarten gesteckt, das war unsere Rettung. Wir wurden frühkindlich gefördert, und deutsche Erzieherinnen nahmen sich unserer an. Wir hatten eine Gemeinschaft von Nachbarn, die mit uns Bücher lasen und uns mitnahmen zu Freizeitaktivitäten, für die meinen Eltern das Geld fehlte. Es gab eine kostenlos zugängliche Bücherei. Wir kamen in dieselbe Schule wie Kinder von Intendanten und Politikerinnen. Es gab keine Segregation, keine Ghettoisierung. Dieses Deutschland, das es damals in Hannover gab, hat mich zu der gemacht, die ich heute bin.
Sie haben 2019 die Bildungsinitiative GermanDream gegründet. Was steckt dahinter?
Wir sind ein Netzwerk von mittlerweile mehr als 500 ehrenamtlichen Wertebotschafter*innen bundesweit. Dazu gehören Prominente wie Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, aber auch Ehrenamtler*innen, Rentner*innen oder Auszubildende. Schulen können sich bei uns melden mit verschiedenen Themen, zu denen Diskussionsbedarf besteht, etwa dem Russland-Ukraine-Konflikt, Antisemitismus, Rassismus, Gesundheitsversorgung oder Identität. Wir vermitteln dann eine Person, die mit den Schüler*innen diskutiert. Das Besondere ist, dass unsere Wertebotschafter*innen Zuwanderungsgeschichte haben, aber nicht ausschließlich. Alle können es werden. Ich bin stolz darauf, dass wir inzwischen jeden Tag an einer deutschen Schule einen Wertedialog haben.
Um welche Werte geht es Ihnen?
Zum Grundkonsens unserer Wertevermittlung gehört, dass wir mit beiden Beinen auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Dazu zählen Werte wie Gleichberechtigung, Selbstbestimmung, Presse- und Religionsfreiheit, aber auch Familie. Es geht darum, die Schüler*innen einzubinden, ihre Denkräume zu erweitern und auch Ängste und Herausforderungen anzusprechen. Wir reden beispielsweise darüber, was persönliche Freiheit im Kontext der Gesellschaft bedeutet und inwiefern sie beschränkt ist. Auch die von mir gegründete wertebasierte Organisationsberatung Mut:Republik verbindet Werte mit sozialer Teilhabe. Unsere Arbeit dort ist getragen von der Überzeugung, dass auch Einzelne etwas bewegen können, wenn sie sich engagieren und mutig für ihre Grundsätze einstehen.
Wo steht Ihrer Ansicht nach der Diskurs über Einwanderung in Deutschland?
Er ist teilweise in den 1980er-Jahren steckengeblieben und spiegelt oft Vorurteile, die in vielen Menschen schlummern. Wenn jemand Ahmed heißt und Mist baut, gehört er am Ende doch nicht wirklich dazu. Es geht aber darum, auch dann ein Teil der Gesellschaft zu sein, wenn man keine Höchstleistungen erbringt. Ein Freund von mir hat einmal treffend gesagt: „Ich möchte auch Fehler machen dürfen und trotzdem dazugehören.“ Deutschland kann es sich schon allein vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels nicht erlauben, Leute zu vergraulen.
Um ausländischen Fachkräften den Zuzug zu erleichtern, plant die Bundesregierung ein neues Fachkräftegesetz, mit einem Punktesystem ähnlich wie in Kanada, das etwa berufliche Qualifikation und Sprachkenntnisse bewertet. Außerdem könnte die Einbürgerung bald bereits nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland möglich sein, statt wie bisher nach acht Jahren. Geht das in die richtige Richtung?
Die Akzeptanz in der Gesellschaft ist schon viel weiter, als uns oft weisgemacht wird. Rechtlich fehlt sie aber noch. Es wird deshalb höchste Zeit, dass mehr für Gleichstellung getan wird. Fachkräfte von außen brauchen wir zwar, dürfen aber gleichzeitig nicht blind sein für das Potenzial im eigenen Land. Wie kann es sein, dass Deutschland in Indien nach Fachkräften sucht, aber die Menschen hierzulande durch Bürokratie daran hindert, in bessere Jobs zu kommen? Nehmen Sie den Fall einer Frau aus Syrien. Sie war dort 30 Jahre lang Lehrerin, bevor sie vor dem Krieg nach Deutschland flüchtete. Hier darf sie aber keine Ausbildung als Kinderpflegerin machen, weil sie nur ein Zeugnis aus der zwölften Klasse vorlegen kann, und nicht aus der neunten oder zehnten wie es die Behörden fordern. Das kann nicht sein.
Menschen mit Migrationshintergrund werden in Deutschland immer noch diskriminiert, etwa wenn es um Teilhabe an Wohnen, Arbeit und Bildung geht. Wo sehen Sie hier derzeit gesamtgesellschaftlich die größten Defizite?
Ich sehe vor allem strukturelle Defizite, da sind andere Länder schon weiter. Bei rassistischer Gewalt sehen wir in Deutschland immer noch viel zu oft weg, tun sie als Einzeltaten ab oder schieben die Schuld in die Richtung der Opfer. Das ist falsch. Wir alle sind dafür verantwortlich.
Wie werden wir dieser Verantwortung gerecht?
Indem wir hinsehen und über Rassismus in Deutschland reden, auch wenn es weh tut. Diese Debatten sind zu wichtig, als dass wir sie nur in Twitter-Echokammern besprechen dürfen. Wir müssen die Dynamiken der Spaltung überwinden. In vielen Bereichen haben es Menschen, die einen bestimmten Hintergrund haben oder aus einer bestimmten Schicht kommen, immer noch sehr schwer. Dabei macht es auch Institutionen und Unternehmen innovativer und wettbewerbsfähiger, wenn sie losgelöst von Vorurteilen einstellen und die Menschen einbinden.
In Ihrem Buch #GermanDream warnen Sie vor der kollektiven Zuschreibung von Opferrollen an Migrant*innen. Was meinen Sie damit?
Wir sind nicht die besseren und nicht die schlechteren Menschen, wir sind genauso wie alle anderen. Die eigene Kraftanstrengung kann einem niemand abnehmen. Es ist wichtig, klarzumachen: Wir sind keine Opfer, sondern „agents of change“. Wir brauchen keine Retter, sondern Dialog auf Augenhöhe. Zu einer diversifizierten Gesellschaft gehört beispielsweise auch, dass wir über Rassismus innerhalb von Migranten-Communities sprechen. Die Trennlinien verlaufen nicht entlang von Nationalität und Religion, sondern entlang der Werte. Unterm Strich geht es darum, Einwanderung nicht als Defizit zu betrachten, sondern als Reichtum, als Schatz. Da haben wir eine Menge zu tun in den kommenden Jahrzehnten. Ich sehe hier viele Herausforderungen, aber auch sehr viel Potenzial.
Literatur
Tekkal, D., 2020: #GermanDream – Wie wir ein besseres Deutschland schaffen. Piper Verlag, Berlin/München.
Düzen Tekkal ist Journalistin, Autorin und Gründerin der Menschenrechtsorganisation Háwar, der Bildungsinitiative GermanDream und der Beratungsfirma Mut:Republik.
Twitter: @germandream_de