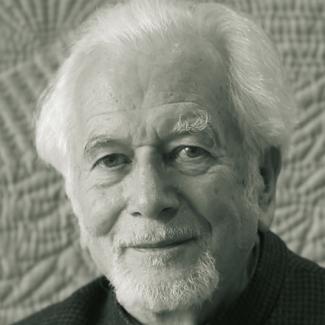Armut
Instabiles Gleichgewicht
Von Martin Kämpchen
Das ausgezehrte Gesicht der Armut offenbart sich nur zögernd. Die Menschen vermögen ihr Leben im Gleichgewicht zu halten – solange sie Arbeit haben, jung und gesund sind und keine familiären Katastrophen eintreten. Gerät aber eines dieser Elemente aus dem Lot, drohen unversehens Not und Leid. Wer kein oder wenig Land besitzt, muss, sobald er sein eigenes Feld bestellt hat, bei benachbarten Großbauern zum Tageslohn arbeiten. Und wenn sie keine Arbeit finden? Geldrücklagen haben sie nicht. Ihre Reisvorräte schwinden. Sie kaufen im Laden im übernächsten Dorf Reis und Gemüse, Öl und Zucker, Gewürze und Kerosin – auf Kredit. Der Ladenbesitzer weiß, dass sein Geschäft nur läuft, wenn er diesen gewährt. Die meisten Dorfbewohner kaufen auf Kredit und bezahlen einmal im Monat die Schulden.
Was aber, wenn der Arbeitslose die Schulden am Monatsanfang nicht begleicht? Der Ladenbesitzer insistiert: Bezahle die Schulden, dann bekommst du wieder Reis! Dieser Mensch wird den Nachbarn oder Onkel um Geld bitten, ihn anflehen. Vielleicht ist er auch zu stolz dazu. Besitzt er etwas, was er verkaufen kann? Den Hochzeitsschmuck seiner Frau? Den versilberten Ring, den ihm sein Schwiegervater zur Hochzeit geschenkt hat? Seine Uhr? Oder soll er woanders Arbeit suchen? In die Großstadt ziehen, nach Kalkutta? Es heißt, da gebe es immer Arbeit …
Sein gewohntes Leben, das sich ein armer Mensch nicht anders vorstellen kann, gerät ins Wanken. Seine Welt zerbricht, er kommt in existenzielle Not. Arme haben keine Fantasie, die ihnen hilft, Wege aus der Not zu finden und diese dann zu beschreiten. Dieser Mangel an geistiger Beweglichkeit ist Teil ihrer Armut, sie erstarren geradezu in ihrer Not. Ohne ihren gewohnten Lebensrhythmus fühlen sie sich aus der Bahn geworfen. Arbeit ist für sie viel mehr Lebenssinn als für wohlhabende Menschen, die arbeiten, um am Wochenende frei zu sein. Für die Armen bedeutet Freizeit meist die wohlige Erschöpfung nach der täglichen Arbeit, das Warten auf weitere Arbeit, darauf, zu feiern.
Die enge Familien- und Dorfgemeinschaft fängt den Menschen in Not nur kurzfristig auf. Ein arbeitsfähiger Mann mit Familie kann sich nicht dauerhaft auf die Großfamilie verlassen. Denn die Armen, zwar zu erstaunlichen Opfern für die Familie bereit, haben begrenzte Möglichkeiten, großzügig zu sein.
Unstrukturiertes Milieu
Die Armen sind den Wechselfällen des Lebens schutzlos ausgesetzt. Vor familiären Katastrophen können sie sich kaum schützen. Beginnen etwa Vater oder Mutter zu trinken oder zu spielen oder begeben sie sich in die Hände von Geldverleihern, stürzt schnell eine ganze Familie in den Ruin. Schlägt ein Mann seine Frau, zwingt er sie, ein Kind nach dem anderen zu gebären, ist sie dem ausgeliefert. Werden die Kinder geprügelt oder wird ihre Arbeitskraft ausgenutzt, gibt es keine Zuflucht für sie.
Das Milieu der Armen zeichnet sich durch Unstrukturiertheit aus. Es kennt keine eindeutige Ordnung, die jedes Mitglied der Gesellschaft bindet und allen eine gewisse Sicherheit gibt. Die wankelmütige, unreflektierte Meinung der Mehrheit herrscht. Die Polizeistation ist weit, das nächste Gericht noch weiter; also halten traditionelle und spontan entstehende Strukturen das Gemeinwohl in fließender Ordnung.
Wird etwa eine Ehefrau tyrannisiert, hält die Familie das geheim, um nicht das Gesicht zu verlieren. Sucht die Frau selbst Rettung – bei Nachbarn oder Mitgliedern der Kaste, des Stammes oder des Dorfes – wird also ihre Not öffentlich, so ergreifen verschiedene Seiten spontan Partei und vertreten verschiedene Meinungen, die sich teilweise heftig entladen. Vielleicht wird der brutale Ehemann verprügelt oder die leidende Ehefrau drangsaliert, weil sie dem Mann seinen Alkoholkonsum nicht zugesteht. Eilig braut sich eine Mehrheit zusammen, die aber nicht ruhig beide Seiten anhört, abwägt und dann entscheidet – Selbstjustiz führt selten zu gerechten und dauerhaften Konfliktlösungen. Die Armen sind ihrer Umgebung ausgeliefert.
Das strenge, oft hartherzige Ehrgefühl der Armen erschwert die Lage. Frauen dürfen nicht beschämt werden und sich niemals zweideutigen Situationen aussetzen. Ein Fehltritt kann sie lebenslang brandmarken. Das Gerücht von einer Liaison, ein Argwohn genügt, um ein Mädchen von der Heirat auszuschließen. Schwächen dürfen keinesfalls öffentlich werden. Gewalt in der Familie, Benachteiligung, Alkoholkonsum oder Krankheiten wie Lepra oder Tuberkulose müssen geheim bleiben. Wehe dem Familienmitglied, das einen Makel öffentlich macht – und sei es, um der Familie zu helfen. Besser nicht zum Arzt gehen, besser keinen Vermittler einschalten. Dies gilt besonders für Hindu- und Muslimdörfer. Die Adivasigesellschaft ist liberaler, auch moralisch toleranter und ahndet Fehltritte nicht mit einer solchen Härte.
Warum haben gerade Arme diesen rigiden Ehrbegriff? Eigentlich haben sie doch nicht viel zu verlieren; wichtiger sind doch Arbeit, Nahrung und Kleidung! Sie selbst empfinden jedoch umgekehrt: Gerade weil sie wenig besitzen, wollen sie wenigstens ihre Unbescholtenheit bewahren und verteidigen sie deshalb mit maßloser Strenge.
Besonders in westlichen Ländern rankt sich ein falscher Mythos um den Begriff Armut. Wir glauben, Armut sei der Mangel an Nahrung, Kleidern, einem Dach über dem Kopf, an Medizin – kurz, ein materieller Mangel. Das stimmt natürlich. Aber Armut ist auch ein mentaler Zustand. Wäre Armut lediglich ein materieller Mangel, so könnte er durch Spenden zum Beispiel behoben werden. Aber so einfach ist das nicht.
Dennoch hält sich diese vereinfachte Sicht im Westen. Man muss spenden, um die Hungrigen zu speisen, die Nackten zu bekleiden, die Kranken gesund zu machen. Der Appell der Bergpredigt klingt in unseren Ohren. Wer spendet, ist frei von Schuld, denn er hat ja „alles“ getan, um zu helfen. Armut ist aber ein komplexer Zustand, der sich nur auf komplexe Weise beheben lässt.
Es ist beunruhigend, wenn arme Menschen idealisiert werden, um Spender zu motivieren. Auf Fotos werden sie als lächelnde, reine, genügsame, edle Menschen gezeigt. Die Oberfläche der Armut, besonders in den Dörfern, ist tatsächlich oft harmonisch, bunt, sogar heiter. Arme sind oft erschreckend fotogen. Aber Bilder reichen nicht. Nur Worte können die vermeintliche Lieblichkeit der Armut relativieren.
Wie oft habe ich vom „Reichtum der Armen“ gelesen – einem reizvollen Wortspiel mit einem Paradox, das aber leider nicht erklärt oder aufgelöst wird. Suggeriert wird, dass arme Menschen sich aufgrund ihrer Armut eine Reinheit und Echtheit bewahrt haben, einen emotionalen und geistigen Reichtum also. Das ist ein gefährliches Spiel mit dem bedrückenden Zustand der Armut und den Gefühlen potenzieller Spender.
Existenzielle Unsicherheit
Also: Armut ist ein mentaler Zustand, der mit der Mangelsituation verzahnt ist. Der Mangel ist Ursache und Folge dieses mentalen Zustands. Aus der materiellen Armut entwickelt sich ein emotionales und mentales Milieu der Armut. Arme können ein volles, sogar erfülltes Leben führen, wie gesagt – solange sie Arbeit haben, gesund sind, sich gut ernähren und es keine Katastrophen in ihrem Umfeld gibt. Ihr Leben ist in einem instabilen Gleichgewicht, das von heute auf morgen umschlagen kann. Die Substanz der Armut besteht darin, dass Arme dieses empfindliche Gleichgewicht nicht bleibend stabilisieren können. Tritt eine Notsituation ein, sind sie unfähig, sie aufzufangen.
Der mentale Horizont der Armen besteht aus existenzieller Unsicherheit und der beständigen Angst vor Veränderung ihres instabilen Gleichgewichts. Sie wollen Stabilität, doch fehlt ihnen meist die intellektuelle, praktische und technische Fähigkeit, einen Weg dahin zu finden. Sie sehen keine Alternative als die, den Weg weiterzugehen, auf den sie das Leben gestellt hat. Statt struktureller Änderung suchen sie Sicherheit in der Gruppe. Statt individuell nach Bildung und materiellem Fortschritt zu streben, suchen sie Schutz im sozialen Netz der Großfamilie, der Dorfgemeinschaft, der Kaste und der Berufsgemeinschaft.