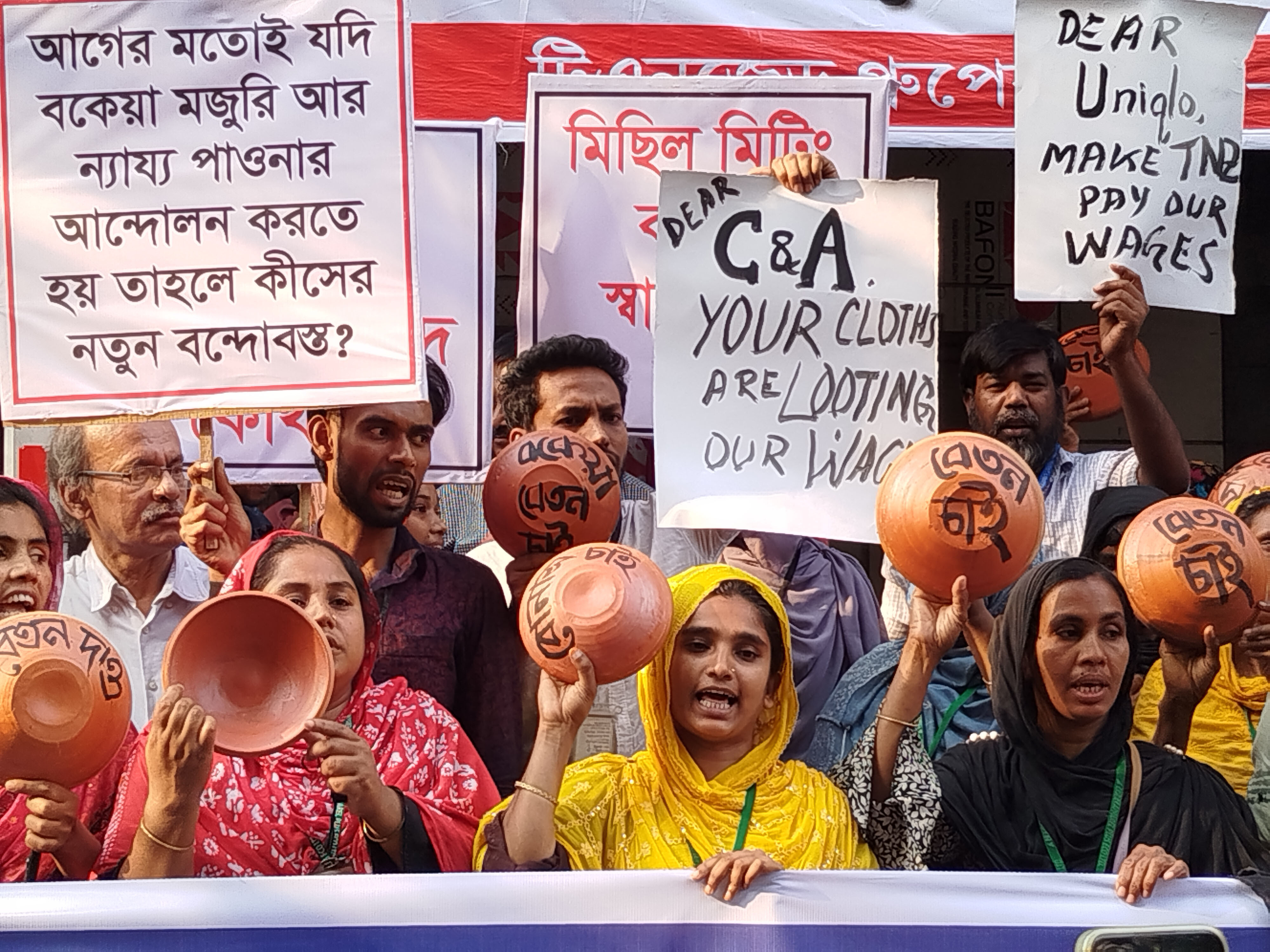Genau hinsehen
In ihrer plattesten Version läuft Globalisierungskritik auf die These hinaus, die Liberalisierung des Welthandels unterwerfe alle Länder dieser Erde der Ausbeutung durch die mächtigsten Konzerne aus den reichen Industrienationen. Die Folge sei dann gnadenlose Standortkonkurrenz, was wiederum zu niedrigen und sinkenden Löhnen führe – sowie zum Unterlaufen sämtlicher Umweltstandards und zur Ausrichtung jeglicher Staatstätigkeit an Kapitalinteressen.
Die Realität ist komplizierter, die Weltwirtschaft ist für viele Überraschungen gut. Dass immer wieder Unternehmen aus Schwellenländern den Anschluss an den internationalen Wettbewerb finden, ist dabei ein vergleichsweise alter Hut. Beispiele aus den 90er Jahren sind der Zementhersteller Cemex aus Mexiko, der Computerproduzent Acer aus Taiwan oder das Konglomerat Samsung aus Südkorea. Namen wie Tata oder Lenovo stehen dafür, dass inzwischen auch Unternehmen aus Indien und China Global Player geworden sind. Und die Mobilfunkgruppe Celtel – heute im Besitz der Zain-Gruppe aus Kuwait – hat bewiesen, dass ein afrikanisches High-Tech-Unternehmen in vielen Ländern seines Heimatkontinents mit Konkurrenz aus Industrienationen mithalten kann.
Derweil leiden Ford und General Motors, einst dominante Konzerne, darunter, dass Washington umwelt- und sozialpolitisch versagt hat. Die Autohersteller aus Detroit versäumten es, energiesparende Modelle zu entwickeln. Zu ihrer Misere trug darüber hinaus der Wettbewerbsnachteil bei, dass sie – mangels staatlicher Sozialpolitik – die Krankenversicherungen ihrer Werksangehörigen komplett selbst schultern müssen.
Eine weitere Überraschung ist, dass seit einiger Zeit gewisse Akteure neu – oder zumindest mit frisch gestärkter Finanzkraft – im grenzüberschreitenden Investitionsgeschäft auftreten. Hohe Exportüberschüsse und Devisenreserven versetzen manche Regierungen in die Lage, mittels Staatsfonds Kapital im Ausland anzulegen. Solche Investitionen können nach reinen Renditekriterien erfolgen, aber auch politischen Zielen dienen. Die Fachwelt diskutiert erregt, was solche Staatsfonds bewirken können – und ob es vielleicht nötig ist, Aktiengesellschaften in Industrienationen vor Anteilskäufen durch solche Investoren zu schützen.
Auch in der Welt der flüchtigen Portfolioinvestitionen hat sich viel getan. Die jüngste Hypotheken- und Immobilienkrise in den USA hat eine Kreditklemme ausgelöst, die der Finanzwirtschaft der reichen Länder zu schaffen macht. „Emerging Markets“, von denen in den 90er Jahren Finanzkrisen ausgingen, gelten dabei plötzlich als vergleichsweise sichere Häfen.
All das bedeutet natürlich nicht, dass die naive Freihandelsideologie zuträfe, der zufolge Liberalisierung automatisch Wohlstand für alle schafft. Keine Frage: In der Weltwirtschaft geht es vielfach brutal und rücksichtslos zu. Unternehmen handeln ihrem Wesen nach profitorientiert – also eigennützig. Aber es stimmt eben auch nicht, dass Profit immer nur auf massenhafter Verelendung beruht. Gesellschaftlicher Wohlstand liegt durchaus auch im Kapitalinteresse. Ohne Kaufkraft wird schließlich niemand zum Kunden. Prosperierende Märkte bieten die besten Absatzchancen.
Die Überraschungen der letzten Jahre zeigen indessen, dass es sinnvoll ist, immer wieder zu prüfen, wie die Wirklichkeit empirisch aussieht. Auf dieser Basis können echte Fehlentwicklungen der Globalisierung kritisiert werden.